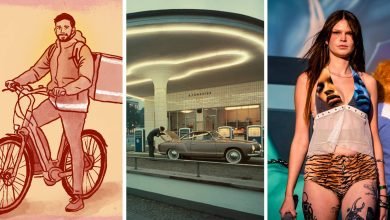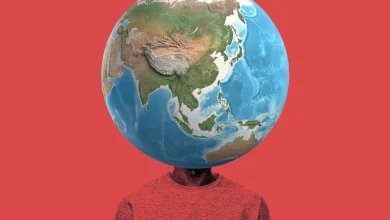TV-Kritik Caren Miosga: Zweifel an Trumps Geduld für dauerhaften Frieden | ABC-Z

Die Kritik am großen Angebot an Fernsehtalkshows hat verschiedene Facetten. Immer wieder müssen sich die Sendungsmacher anhören, ihre Einladungslisten seien unausgewogen, setzten auf die immergleichen üblichen Verdächtigen. Gäste mit einer Handvoll Botschaften diskutierten wiederkehrende Großthemen, ohne zum Kern vorzudringen. Gastgeber bevorzugten bestimmte Positionen und ließen ihnen mehr Raum als anderen, Lieblingsgäste würden mit Samthandschuhen, ihre Kritiker überhart angefasst. Für all diese Punkte gibt es bessere und schlechtere Belege.
Die besondere Stärke einer Fernsehtalkshow ist es indes, in eine aktuelle politische Lage mehr Klarheit zu bringen und im Idealfall durch eine durchdachte Zusammensetzung der Diskussionsteilnehmer unterschiedliche Dimensionen eines Themas zu beleuchten, das nach Deutung ruft.
Die Lage im Nahen Osten verlangte nach dem vermeintlichen Friedensschluss von vergangener Woche nach einer solchen Einordnung – erst recht, nachdem der neuerliche Beschuss Israels und das Einbehalten von mehr als einem Dutzend Leichen von israelischen Geiseln durch die Hamas die Frage aufwirft, ob das vom US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump eingefädelte Abkommen eine Woche später überhaupt noch gilt.
Außenpolitik kann analytischer verhandelt werden
Außenpolitische Themen haben auf den Verlauf der Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen im positiven Fall (und wenn politische Extrempositionen nicht vertreten sind) eine gute Wirkung: Sie verlaufen weniger emotional und stocken selten bei schwer zu überwindenden ideologischen Grundkonflikten, die sich nicht innerhalb einer Stunde vor laufender Kamera aufheben lassen. Wenn es gut läuft, bringen sie stattdessen die angestrebte Einsortierung brandaktueller Ereignisse in einen größeren Kontext.
Der Sendung „Caren Miosga“ ist das am Sonntagabend gelungen, indem sie eine der Stärken dieses Formats ausspielte und ihre ebenfalls vorhandenen Schwächen ausglich. Es war eine konzentrierte Folge mit vier gut vorbereiteten, meinungsstarken und zumeist um Ausgleich bemühten Gesprächspartner. Das war nicht schrill, ließ den Puls nicht steigen.
Es wurde respektvoll über tote Palästinenser nach israelischen Gegenschlägen, über hungernde Bewohner von Gaza und über israelische Opferfamilien gesprochen. Sieht man sich die Besetzungsliste der Talkshow an, fällt auf: Es war niemand von einer extremen gesellschaftlichen Gruppierung dabei, das Diskussionsniveau war hoch.
Besetzung des Abends erlaubte guten Verlauf
Die Besetzung begünstigte dies. Mit Omid Nouripour (Grüne) vertrat ein erfahrener Außenpolitiker die politische Sphäre, der durch sein Amt des Bundestagsvizepräsidenten auch zu einer gewissen Überparteilichkeit verpflichtet ist. Die Unternehmerin Jenny Havemann konnte das Leid israelischer (und im kurzen Schlussblock zur Ukraine auch ukrainischer) Familienangehöriger seit dem 7. Oktober 2023 schildern. Für analytische Beiträge waren der Terrorismusforscher Peter Neumann und die „Zeit“-Journalistin Anna Sauerbrey eingeladen. Eine Einladungspolitik, die erlaubte, dass sich die Sendung in ihrem Verlauf weiterentwickelte.
Abgesehen von einer kleinen Kontroverse, ob das UN-Nothilfeprogramm UNRRA wegen seiner nachweislichen Nähe zur Hamas aufgelöst werden muss, blieben griffige Streitpunkte aus. Aber angesichts der bedrückenden Entwicklung in Gaza nach einem hoffnungsvollen Beginn der Waffenruhe wäre Konflikt auch nicht der passende Modus der Diskussionssendung gewesen.
Insofern lässt sich der Inhalt der Sendung kompakt zusammenfassen: Alle vier Teilnehmer waren sich einig, dass die Hamas die Waffenruhe allein schon dadurch gebrochen habe, dass 16 Leichen von Geiseln noch nicht wie zugesagt an Israel übergeben worden sind. Trump habe sich womöglich zu früh für seinen Verhandlungserfolg feiern lassen. Nach Neumanns Analyse zeige sich mit der Rückkehr von freigelassenen Häftlingen und Zehntausender Bewohner von Gaza, dass in einem derzeit bestehenden Führungsvakuum die Hamas ihr Gewaltmonopol verteidigen wolle, um ihr Bestehen zu sichern.
Israelis finden nach Geiselrückkehr zur Konzentration
Humanitäre Hilfe müsse zu den Menschen gelangen können. Gleichzeitig sei davon auszugehen, dass sich die innenpolitischen Proteste gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu fortsetzen würden. Havemann beschrieb die Freude über die Rückkehr der lebenden Geiseln in der vergangenen Woche. Erst dadurch sei es für viele Israelis möglich gewesen, nach dem Hamas-Anschlag vor zwei Jahren wieder zu neuer Konzentration zu finden. Erst das könne auch Raum schaffen, um die Ereignisse und die Fehler Israels aufzuarbeiten, betonte Sauerbrey. Nach aktuellen Umfragen habe Netanjahu gute Chancen, im kommenden Jahr wiedergewählt zu werden.
Schwierigster Punkt des Abkommens ist nach Neumanns Einschätzung die Entwaffnung der Hamas. Dieser Passus habe sehr viel Sprengkraft. Zu Beginn seiner wissenschaftlichen Tätigkeit habe er sich viel mit dem Nordirlandkonflikt beschäftigt. Zwischen der ersten Waffenruhe und der Befriedung hätten elf Jahre gelegen. „Ich bin mir nicht sicher, ob Trumo die Geduld hat“, sagte er. Nouripour ergänzte, der Entwaffnung fehle es an Verbindlichkeit, weil Trump ausgeschlossen hat, dass amerikanische Truppen in Gaza eingesetzt werden. Gleichzeitig sei fraglich, ob er auf Partner in der arabischen Welt ausreichend einwirken könne, die Hamas in ihre Wirkung zu beschränken.
Die derzeitige Propaganda der Terrorgruppe suggeriere das Bild, sie sei wieder auf der Straße, sagte Neumann. „Hamas hat bislang noch nicht zugegeben, dass sie den Konflikt verloren hat.“ Die Absicht des Abkommens, die Machtverhältnisse im Küstenstreifen neu zu ordnen, passe nicht zu ihrem Ziel, weiterhin die politische Hegemonie in Gaza auszuüben.
Hamas ist nicht vertrauenswürdig
Seit ihrem Wahlsieg im Jahr 2006 habe es immer wieder Phasen gegeben, in denen die Bevölkerung ihren Unmut äußern konnte, sagte Noripour. „Aber Hamas hat immer mit größter Härte zugeschlegen. Sie tut nach Innen alles, um ihre Macht zu erhalten.“
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass in der aktuellen Situation ein großes Enttäuschungspotential liege. Die Versprechen des Abkommens, die Aussicht auf eine stabile Nahrungsmittelversorgung würden abermals konterkariert durch Kämpfe. „Die Leute müssen erleben, dass die Waffenruhe etwas bringt“, sagte Nouripour.
In der letzten Viertelstunde kreiste die Runde um die Frage, welche Schlussfolgerungen aus dem fraglichen Friedensschluss für den russischen Krieg gegen die Ukraine zu schließen ist. Noch immer stehe der mögliche Wunsch nach einem schnellen „Deal“ im Raum, betonten die Teilnehmer.
Schlussfolgerungen auf den Krieg in der Ukraine
Doch wie brüchig solche Vereinbarungen sind, habe der Nahe Osten gezeigt. Trump könnte eine realpolitische Wende hinlegen, sagte Sauerbrey. Wie im Fall Israel-Palästina bemühe er sich verstärkt darum, auf Akteure (wie etwa Indien) einzuwirken, die einen Einfluss auf Wladimir Putins Russland ausüben können. Dass den unterlegenen Ukrainern in solchen Gebieten, die Russland vollständig erobert hat, Vergewaltigung und Unterdrückung drohe, trübe die Aussicht auf schnelle Lösungen, sagte Nouripour.
Nach einer Stunde „Caren Miosga“ hatte man an diesem Sonntagabend nicht den Eindruck, ohne Erkenntnisgewinn aus der Sendung herausgegangen zu sein. Die aktuellen Entwicklungen des Wochenendes zeigten, dass Themen- und Teilnehmerauswahl sinnvoll waren.
Die Moderatorin hat es mit ihren Fragen hinbekommen, einen natürlich wirkenden Fluss der Unteraspekte zu erzeugen. Die Voraussetzungen für einen solch positiven Verlauf lassen sich als einige Grundregeln des Talkshowwesens festhalten: eine Thema mit aktuell hohem Erkenntnisinteresse und Erklärungsbedarf, Gesprächspartner mit hoher Expertise und/oder Involviertheit, politische Kontroversen nicht unterdrücken, aber auch nicht künstlich durch die Einladung schriller politischer Gäste überbetonen, Aufgeregtheit durch Routine abfedern, ohne in verklärte Langeweile abzudriften.