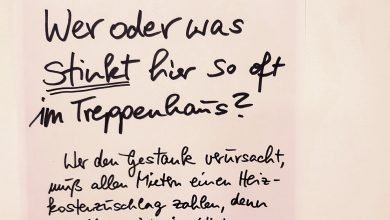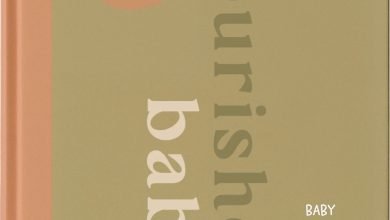Streit um Spitzengehälter: Trauriger Populismus | ABC-Z

E s ist eine Debatte, die schwer zu führen und noch schwerer zu gewinnen ist. 300.000 Euro jährlich sollen nicht genug sein für den Vorstandschef oder Geschäftsführer an der Spitze eines großen landeseigenen Unternehmens? Wie läst sich das jemandem erklären, der ordentlich seinen Job macht, aber auf Mindestlohnbasis bezahlt wird und am Monatsende in ein leeres Portemonnaie guckt? Fast unmöglich – jedenfalls in der Kürze der Zeit, die man als Politiker samstagsmorgens am Infostand vor dem Supermarkt dafür hat – wenn überhaupt mal jemand für eine Minute stehen bleibt.
„Die da oben machen sich die Taschen voll“ ist ohnehin ein gängiges Narrativ. Und weil es immer wieder gut bezahlte vermeintliche Topmanager gibt, die ihren Job eben nicht gut machen, zieht auch das Gegenargument oft nicht, diese „da oben“ seien durchaus ihr Geld im Sinne der Allgemeinheit wert. Dann wie SPD-Fraktionschef Raed Saleh von einem „Gerechtigkeitsthema“ zu sprechen und zu kritisieren, die Gehälter seien „teilweise unverschämt hoch“, hört sich vor diesem Hintergrund richtig gut an.
Und doch passt für die SPD-Forderung nach deutlicher Absenkung und Deckelung der Vorstandsgehälter bei den Landesbetrieben – die jetzt bis an eine halbe Million Euro heranreichen – genau das Wort, mit dem CDU-Vize-Fraktionschef Michael Dietmann darauf reagiert hat: populistisch. Die Lage ist nämlich bei weitem nicht so einfach, wie sie die SPD darstellt.
Wenn man in Berlin auf der Suche nach einer solchen Führungskraft ist, dann geht der Blick auch darauf, wer anderswo seinen Job an der Spitze oder in der zweiten Reihe auffällig gut gemacht und für Berlin in Frage käme. Der wird jedoch schon in seiner jetzigen Position gutes Geld verdienen und nicht allein deshalb wechseln wollen, weil Berlin so eine schöne Stadt ist. Und er wird, wenn er durch gute Leistung auf sich aufmerksam gemacht hat, auch von anderen Unternehmen angesprochen werden.
Geld schießt Tore
Es gibt also ein Konkurrenzverhältnis – umso mehr, wenn es um Landesunternehmen geht, die wie die BVG oder die BSR die größten ihrer Art in Deutschland sind. Um einen Vergleich mit dem Fußball zu ziehen: Der FC Bayern München sucht seinen nächsten Trainer auch nicht in der Ober-, geschweige denn in der Bezirksliga. Und zahlt ordentlich dafür, nach dem Diktum von Bayern-Legende Hoeneß, dass Geld eben Tore schießt.
Manche Vereine setzen zwar in der Not auf den eigenen Nachwuchs und füllen ihre Mannschaft aus der eigenen A-Jugend auf. Aber zum einen funktioniert das auch nicht immer. Zum anderen hat ein Fehlgriff beim Fußball nur für die Tabellensituation Folgen. Bei einem Unternehmen aber leiden darunter viele hunderte oder tausende Beschäftigte – und unzählige Berliner, für die dieser Landesbetrieb Dienstleistungen erbringt.
Falls dieser Nachwuchs aber wirklich gut ist, bleibt der im eigenen Laden auch nur bei einer Bezahlung, die bei landeseigenen oder kommunalen Unternehmen vor allem in Westdeutschland üblich ist. Dietmann und andere Stimmen bei der CDU verteidigen ja nicht einmal das bundesweit hohe Gehaltsniveau bei Topmanagern an sich. Sie weisen lediglich darauf hin, dass sich Berlin nicht einfach aus diesem System ausklinken und erwarten kann, die gewünschten Leute für Gehälter weit unter Marktniveau zu bekommen.
An dieser Stelle der Debatte kommt gern der Hinweis darauf, dass der höchstbezahlte Landespolitiker der Stadt teilweise noch nicht mal halb so viel verdient wie die Chefs großer landeseigener Unternehmen, und dass die deshalb ja wohl auch mit weniger auskommen könnten. Das aber lässt sich schlicht nicht vergleichen. Kai Wegner von der CDU wollte gewiss nicht Regierender Bürgermeister werden, um die dafür gezahlten 212.000 Euro zu verdienen, genauso wenig wie vor ihm Franziska Giffey von der SPD.
Nicht mit Spitzenjobs in der Politik zu vergleichen
Beide würden wahrscheinlich noch Geld mitbringen, um den Job zu machen, weil sie davon angetrieben sind, Dinge in ihrer Stadt verändern zu wollen. Ohne solches Feuer übernimmt niemand einen 7-Tage-Arbeitsplatz, der kaum noch Privatleben lässt. Ob das, was sie da verändern wollen, in den Augen anderer gut oder schlecht ist, ist eine ganz andere Frage.
Von einem aufsteigenden Unternehmensmanager aber ist bislang selten bis nie zu hören gewesen, dass er oder sie aus ähnlich intrinsischer Motivation nach Berlin gekommen ist. Also um sich hier den Lebenstraum zu erfüllen, der BVG, der BSR oder den Wasserbetrieben vorzustehen und dafür auf hunderttausende Euro pro Jahr zu verzichten, die es anderswo zu verdienen gibt.
Falls nun jemand auf den Gedanken kommen sollte, niedrigere Vorstandsgehälter könnten ja auch dem unter Spardruck stehenden Landeshaushalt helfen: Da spielt eine Deckelung erst gar keine Rolle. Als der Landesrechnungshof 2024 die Höhe der Spitzengehälter bei fünf großen landeseigenen Unternehmen prüfte, deren Höhe rügte und eine Absenkung empfahl, hatte er auch ausgerechnet, was das einsparen würde: 2,1 Millionen Euro jährlich – der aktuelle Landeshaushalt umfasst rund 40.000 Millionen.
Der Erfolg verkürzter Botschaften
Diese Abwägung in Ruhe zu lesen, dürfte drei, vier Minuten gedauert haben. Das ist gut drei bis vier Mal so lang, wie der eingangs erwähnte Politiker am Infostand in der Regel Zeit hat, für oder gegen etwas zu argumentieren.
Deshalb ist er ja so erfolgreich, der Populismus von rechts wie links – weil er einfache Botschaften aussendet, die auf die Schnelle nicht zu widerlegen sind. Das ist ein trauriger Schluss und für den Wahlkampf hin zur Abgeordnetenhauswahl in nun weniger als elf Monaten kein ermutigendes Vorzeichen.