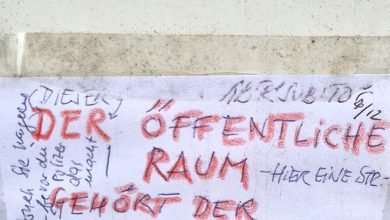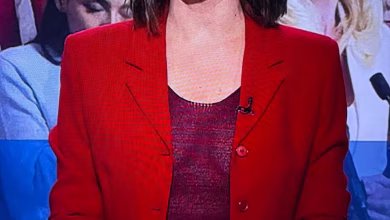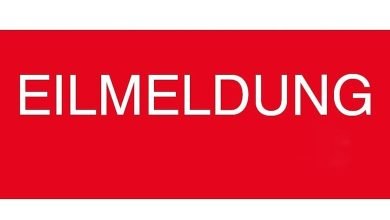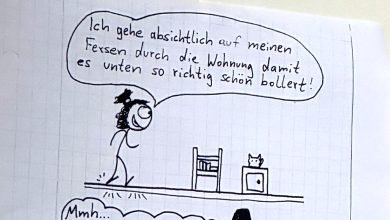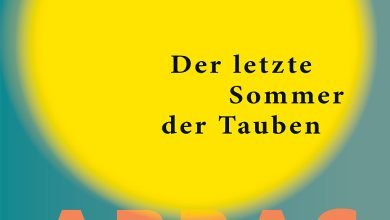Arno Merk aus Peine wirft Ex-Weltmeister Wright raus | ABC-Z

Der deutsche Debütant Arno Merk hat bei der Darts-WM einen beeindruckenden Überraschungserfolg gelandet und Publikumsliebling Peter Wright aus dem Turnier geworfen. Im Alexandra Palace von London setzte sich der 33 Jahre alte Niedersachse glatt mit 3:0 gegen den zweimaligen Weltmeister aus Schottland durch.
Eiszeit – der Eisbären-Newsletter
Jeden Donnerstag alles Wichtige von den Eisbären Berlin – Highlights, News und spannende Einblicke.
Eiszeit – der Eisbären-Newsletter
Jeden Donnerstag alles Wichtige von den Eisbären Berlin – Highlights, News und spannende Einblicke.
Werbevereinbarung
zu.
„Unfassbar, einfach geil. Ich bin immer noch ein bisschen am Zittern, mein Herz rast noch. Ich bin überglücklich“, sagte Merk nach dem größten Einzelerfolg in seiner bisherigen Laufbahn bei DAZN. „Klar, Peter hat nicht sein bestes Spiel gemacht, aber ich habe nix anbrennen lassen.“

Merk als vierter Deutscher in Runde drei
Während Merk völlig unbeeindruckt sein Spiel durchzog, wirkte Wright völlig indisponiert. Der schottische Paradiesvogel, der diesmal mit lila Haaren antrat, traf gleich mehrere Male falsche Doppelfelder und leistete sich Fehler um Fehler. Immer wieder wechselte Wright während der Partie seine Pfeile, doch besser wurde es nicht. Wright war 2020 und 2022 Weltmeister im Ally Pally.

In der dritten Runde bekommt es Merk entweder mit Michael van Gerwen aus den Niederlanden oder mit William O‘Connor aus Irland zu tun. Nach Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Gabriel Clemens ist Merk der vierte Deutsche, der bei dieser WM in Runde drei steht. Bei keinem Profi kommt dieser Schritt so überraschend wie bei Merk, der vor einigen Monaten noch am Reality-TV-Format Darts-Party bei Sport1 teilnahm.
Wright kommt mit Weihnachtsmusik auf die Bühne
Das Einzige, was bei Wright stimmig war, war sein Einlauf. Statt zu „Don‘t Stop The Party“ wie üblich kam der Routinier am Tag vor Heiligabend diesmal zu „Do They Know It’s Christmas“ auf die Bühne. Der sportliche Auftritt geriet dann zu einem Desaster.
„Wenn ich mein Spiel mache, kann ich ihn auch in einer guten Verfassung schlagen“, hatte Merk vorab gesagt. Doch davon war Wright weit entfernt. Der zweimalige Weltmeister könnte nach dem frühen WM-Ausscheiden aus den Top 32 der Rangliste fallen