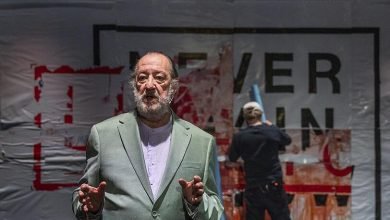Dieselskandal: Zehn Jahre später – Folgen für VW und die Branche | ABC-Z

Helles Tageslicht fällt an einem Montag Ende Mai durch die Fenster von Saal 141 des Landgerichts Braunschweig. Die Holzvertäfelung aus amerikanischer Weißeiche wirkt nüchtern, der Schwurgerichtssaal fast kühl. Am Ende eines jahrelangen Strafprozesses hören vier ehemalige Volkswagen -Manager an diesem Tag ihre Urteile. Einer vergräbt das Gesicht in den Händen: zwei Jahre und sieben Monate Haft. Der Mitangeklagte wenige Meter weiter: viereinhalb Jahre Gefängnis. Es sind klare Urteile. Doch ein Ende des Dieselskandals markieren sie nicht. Alle vier legen Revision ein. Und gegen den prominentesten Beschuldigten, den einstigen VW-Chef Martin Winterkorn, wird wohl nie ein Urteil fallen. Die Gesundheit des 78 Jahre alten früheren Managers ist schwer angeschlagen, das Verfahren gegen ihn vorläufig eingestellt.
So ist der Stand der Aufarbeitung eines der größten Industrieskandale. An diesem Donnerstag jährt er sich zum zehnten Mal. Am 18. September 2015, mitten in die Automobilausstellung IAA, die damals in Frankfurt stattfand, war die Nachricht hereingeplatzt, dass VW die Abgaswerte von Millionen Dieselautos manipuliert hat.
Die „Notice of Violation“ der US-Umweltbehörde EPA löste einen Sturm aus. Fünf Tage später trat Winterkorn zurück, in Amerika folgten Milliardenstrafen und Vergleiche, weitere Länder ließen den Konzern zahlen. Zugleich begann der Abwehrkampf. VW hält bis heute daran fest, der Eingriff in die Motorsteuerung sei „nur nach US-amerikanischem Recht unzulässig“ gewesen. Der Vorstand habe bis kurz vor öffentlichem Bekanntwerden der Manipulationen keine Kenntnis davon gehabt. Herbert Diess, einer von Winterkorns Nachfolgern, hat zwar schon im Sommer 2019, also wenige Jahre nach Bekanntwerden des Skandals, im Fernsehen offen von Betrug statt von „Dieselthematik“ gesprochen – ein Bruch mit der bis dahin beschönigenden Sprachregel. Doch das wurde im Konzern als unglückliche Formulierung abgetan.
Der Skandal ist viel mehr als ein Rechtsfall. Er ist als Zäsur in die Wirtschaftsgeschichte eingegangen und bildet rückblickend den Auftakt eines beispiellosen Krisenzyklus. Für die deutsche Autobranche sei es „der erste wirklich schwere Blechschaden“ gewesen, sagt ein Aufsichtsrat. Der beschleunigte Umbruch zur E-Mobilität, Corona, die Chinaschwäche und jetzt Trumps Zölle – in der Zeit danach folgte ein Schlag dem nächsten. Jack Ewing, ein amerikanischer Journalist, der eines der bekanntesten Bücher über den Dieselskandal geschrieben hat, spricht von einer „Identitätskrise“, die das „Momentum der deutschen Autoindustrie gebrochen“ habe. Lange wähnte man sich vorn. Dann standen die Ingenieure als Betrüger da.
Die Abgasmanipulationen hatten ihren Ausgangspunkt kurz nach der Jahrtausendwende. Toyota feierte damals in Amerika mit Hybridmodellen wie dem Prius unerwartete Erfolge. VW wollte mit „sauberen“ Dieseln kontern – in der deutschen Selbstwahrnehmung eine Paradedisziplin, in den USA jedoch ein Nischensegment. Die strengeren US-Grenzwerte erwiesen sich als Hürde. Aus der Not entstand dann eine Technik, die die Abgasreinigung auf der Straße unbemerkt herunterdrosseln sollte, mit fatalen Folgen. Mehr als 33 Milliarden Euro hat der Skandal den Konzern bis heute gekostet.
Während die US-Justiz zügig handelte und sogar Topmanager inhaftierte, zog sich die Aufklärung in Deutschland hin. Bis heute gibt es kein rechtskräftiges Urteil in einem Strafprozess. In München verhandelte eine Strafkammer mehr als zwei Jahre gegen den früheren Audi -Chef Rupert Stadler und Mitangeklagte. Nach einem Deal mit ersten Urteilen wurden Bewährungs- und Haftstrafen angefochten, der Bundesgerichtshof (BGH) hat über die Revision noch nicht entschieden.
Nach F.A.Z.-Recherchen hat das Landgericht München II nun eine zweite Anklage gegen mehrere Audi-Manager zur Hauptverhandlung zugelassen. Sie richtet sich gegen drei frühere Vorstände und einen Hauptabteilungsleiter wegen Betrugs, mittelbarer Falschbeurkundung und strafbarer Werbung. Die Vorstände sollen zwischen Oktober 2013 und September 2015 von den Manipulationen erfahren, den weiteren Verkauf der Autos aber nicht gestoppt haben. Betroffen sind mehr als 434.400 Autos in Amerika und Europa – nicht nur Audi-Modelle, sondern auch VW und Porsche, die Audi-Motoren nutzten. Ein Manager soll seine Rolle vor seinem Aufstieg in den Vorstand im Jahr 2016 verschwiegen haben, um seine Vergütung nicht zu gefährden. Ein Justizsprecher bestätigte, dass das zweite große Dieselverfahren in München im Januar beginnen soll. Auch in Braunschweig rollt im November ein weiterer Strafprozess gegen frühere Führungskräfte an. Angesetzt sind dort 100 Verhandlungstage.
Alles in allem waren hierzulande mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge betroffen. Der Bundesgerichtshof fällte mehrere Grundsatzurteile zugunsten von Kunden, die in Zivilprozessen Schadenersatz verlangten. Doch überall in Deutschland gibt es weiter Klagen. „Für uns ist die Geschichte noch nicht auserzählt“, sagt Philipp Caba von der Kanzlei Gansel Rechtsanwälte, die in den Spitzenzeiten des Konflikts weit mehr als 10.000 Vergleiche für VW-Kunden ausgehandelt hat. Von der deutschen Ziviljustiz sei er „desillusioniert“, sagt der Berliner Rechtsanwalt. In anderen EU-Staaten und in Amerika sei der Skandal aus Verbrauchersicht viel effektiver abgehandelt worden. Als Hauptgrund führt Caba die Furcht in Politik, Justiz und Unternehmen vor einer „Klageindustrie“ sowie fehlende Kollektivklageinstrumente an. In Deutschland habe man „Ursache und Wirkung“ verwechselt und die Kläger statt die Schädiger als Grund für eine überforderte Ziviljustiz ausgemacht.
Die Branche dagegen will vom Dieselskandal nichts mehr wissen. Auf der nun in München beheimateten IAA hat sie gerade Elektroautos en masse gezeigt. Oliver Blume, der aktuelle Vorstandschef des VW-Konzerns, bemüht sich nach vielen Rückschlägen um Aufbruchsstimmung. Dass ausgerechnet die Abgasmanipulationen die Wende hin zum E-Antrieb beschleunigt haben, darüber denkt heute kaum noch jemand nach. Sichtbar ist allerdings: VW findet in Amerika noch immer keinen festen Tritt. Der Vorstoß mit vermeintlich sauberen Dieselfahrzeugen endete im Debakel, nun müssen Blume und seine Manager mit Trumps Protektionismus umgehen. Und manche US-Kunden verbinden VW noch immer mit unsauberem Geschäft. Zehn Jahre ist der Skandal alt – doch seine Folgen werden noch viel länger dauern.
Der lange Weg vom Skandal zur Aufklärung
Manipulationen, Rücktritte und erste Gerichtsurteile: Die wichtigsten Stationen seit der Enthüllung der Volkswagen-Dieselaffäre in Amerika.