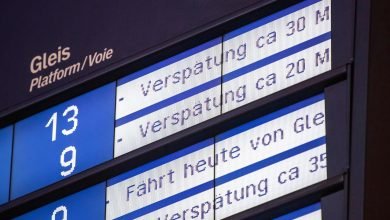Union sieht “Inszenierung” von Pro Asyl bei Urteil zu Zurückweisungen | ABC-Z

Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze sind rechtswidrig – so das Urteil eines Berliner Gerichts. Die Union wirft nun Pro Asyl vor, die Entscheidung provoziert zu haben. Die Hilfsorganisation weist die Vorwürfe zurück.
CDU und CSU werfen der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl vor, das jüngste Gerichtsurteil gegen Grenzzurückweisungen provoziert zu haben. Konkret geht es um den Fall der vom Berliner Verwaltungsgericht für rechtswidrig erklärten Zurückweisungen an der deutsch-polnischen Grenze.
Der neue Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann spekuliert in der Augsburger Allgemeinen über eine Unterstützung der Somalier durch Helferinnen und Helfer aus Deutschland bereits vor der Einreise. Pro Asyl wies die Anschuldigungen in der Zeitung scharf zurück.
“Merkmale von Fälschungen”
Hoffmann sagte, der Fall der drei Asylsuchenden aus Somalia trage “fast absurde Züge” und deute auf eine “Inszenierung” hin: “Pro Asyl ist schon seit Jahren entlang der Fluchtrouten unterwegs, auch an den Grenzübergängen. Dort wird Flüchtlingen empfohlen, ihre Ausweise wegzuwerfen, weil das eine Abschiebung aus Deutschland deutlich erschwert.”
Hoffmann sagte konkret zum Fall der drei Asylsuchenden aus Somalia: “Eine Person war bei den ersten beiden Einreiseversuchen volljährig und ist beim dritten Versuch auf einmal minderjährig, sie hat Ausweisdokumente dabei, die Merkmale von Fälschungen aufweisen.” Alle drei Personen hätten nagelneue Handys gehabt, mit denen man die Reiseroute nicht zurückverfolgen könne. “Für mich trägt das klare Züge einer Inszenierung durch Asyl-Aktivisten.”
Scharfe Kritik auch aus der CDU
In der Bild-Zeitung warf auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, Pro Asyl im Zusammenhang mit den drei somalischen Asylbewerbern vorsätzliche Unterstützung bei illegalen Grenzübertritten vor und verdächtigte die Organisation, noch weitere Straftaten begangen zu haben.
Pro Asyl habe damit selbst eine Grenze überschritten, so der CDU-Politiker weiter – “insbesondere, weil bei einer somalischen Frau die Passpapiere verändert wurden und sie auf einmal minderjährig sein soll”. Die Bundespolizei müsse jetzt sehr genau ermitteln, wie es zu den Grenzübertritten gekommen sei “und ob dabei rechtswidrige Handlungen von Unterstützern vorgenommen wurden.
Pro Asyl: “Falsche Unterstellungen”
Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Karl Kopp, entgegnete in der Augsburger Allgemeinen, diese Vorwürfe hätten nichts mit den Fakten zu tun. “Wir sind eine Menschenrechtsorganisation und unterstützen Geflüchtete vor Gericht”, betonte er. “So war es auch im Fall der drei Menschen aus Somalia, von denen eine Frau noch minderjährig ist.” Dass man Menschen empfehle, ihre Ausweise zu entsorgen oder neue Handys anzuschaffen, seien falsche Unterstellungen. “Damit wird unsere Arbeit angegriffen.”
Das Verwaltungsgericht Berlin hatte am Montag in einer Eilentscheidung festgestellt, dass die Zurückweisung der drei Somalier bei einer Grenzkontrolle am Bahnhof Frankfurt (Oder) rechtswidrig gewesen sei. Ohne eine Klärung, welcher EU-Staat für einen Asylantrag der Betroffenen zuständig sei, dürften sie nicht abgewiesen werden. Die drei Betroffenen waren nach Polen zurückgeschickt worden. Mittlerweile befinden sich die Asylsuchenden wieder in Berlin, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres sagte.
Dobrindt hält an verstärkten Grenzkontrollen fest
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will ungeachtet dessen an verstärkten Grenzkontrollen fest und will den Europäischen Gerichtshof über die umstrittenen Zurückweisungen entscheiden lassen. Das Berliner Verwaltungsgericht habe in seiner jüngsten Entscheidung angemerkt, dass die Begründung für die Anwendung von Artikel 72 – einer Ausnahmeregel im Europäischen Recht – nicht ausreichend sei, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “Wir werden eine ausreichende Begründung liefern, aber darüber sollte der Europäische Gerichtshof entscheiden.”
Dobrindt sagte weiter: “Ich bin der Überzeugung, dass wir uns mit unseren Maßnahmen innerhalb des europäischen Rechts bewegen.” Man müsse die Migrationswende auch deswegen herbeiführen, um zu vermeiden, dass politische Kräfte wie die AfD in die Lage kämen, radikale Lösungen umzusetzen. Ein mögliches Veto des Europäischen Gerichtshofs gegen Zurückweisungen würde er aber “selbstverständlich” akzeptieren, so der Innenminister.
Miersch sieht dagegen Handlungsbedarf
Im Gegensatz dazu sieht SPD-Fraktionschef Matthias Miersch nach der Berliner Entscheidung zur Zurückweisung Handlungsbedarf für Schwarz-rot. “Pauschale Rückweisungen wird es aus meiner Sicht nicht mehr geben können, weil die Gerichte das stoppen werden”, sagte Miersch der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Miersch sagte, der Beschluss des Gerichts werfe sehr grundsätzliche Fragen auf. Die schwarz-rote Regierung werde sich damit auseinandersetzen müssen. “Das hat der Kanzler im Übrigen auch sehr deutlich erklärt, als er sagte, dass vor dem Hintergrund dieser gerichtlichen Entscheidung die Praxis noch mal überprüft werden muss”, sagte Miersch. “Und das erwarte ich jetzt auch, weil wir ansonsten erleben werden, dass wir in den nächsten Monaten weitere Verfahren verlieren.”