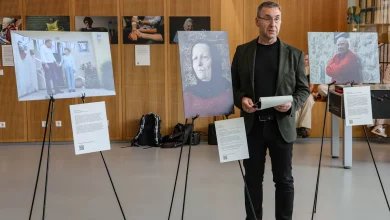Trauer um Hans-Günter Richardi – Dachau | ABC-Z

Zuletzt plagten Hans-Günter Richardi doch Zweifel, ob nicht alles umsonst war und sein letzter großer Wunsch unerfüllt bleiben würde. Auf die Frage, was er sich zum 80. Geburtstag wünsche, hatte der Journalist und Zeitgeschichtsforscher erklärt: „Dass meine Arbeit fortgeführt wird und dass es hoffentlich keinen Rückfall in schlimme Zeiten gibt.“ Dann, sagte Richardi, hätte es sich gelohnt, das alles zu erforschen.
Das war im Oktober 2019. Die schlimmen Zeiten zogen herauf. Besorgt verfolgte Richardi den Rechtsruck, die Wahlerfolge der geschichtsrevisionistischen AfD, und er kritisierte die Politiker der demokratischen Mitte, dass sie viel zu wenig gegen den erstarkenden Rechtsextremismus und Antisemitismus tun würden. Die Angriffe auf die Erinnerungskultur nahm er persönlich – klar, er hatte sich doch sein Leben lang für die Aufklärung über die NS-Verbrechen eingesetzt.
„Diese Begegnung mit den politischen Häftlingen hat mich unglaublich geprägt“
Aber in einem hat sich Richardi geirrt: Seine Forschungen, seine publizistische Arbeit (insgesamt 40 Bücher) haben sich gelohnt. Der Berliner, der 1969 mit seiner Frau Christa nach Dachau zog, hat das Gesicht der Stadt verändert, einen großen Beitrag dafür geleistet, dass die Stadtpolitik und die Bevölkerung nach Jahrzehnten der Leugnung und Abwehr zu einem aufgeklärteren Umgang mit dem nationalsozialistischen Erbe gefunden haben. Der Titel seines vielleicht einflussreichsten Buches „Die Schule der Gewalt“ über die Frühzeit des 1933 eröffneten Lagers hat heute einen festen Platz in der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte. Das 1983 veröffentlichte Buch basiert auf zahlreichen Gesprächen mit Überlebenden. An oral history, dem Sprechenlassen von Zeitzeugen, hatte die damalige Geschichtsschreibung nicht gerade großes Interesse. „Diese Begegnung mit den politischen Häftlingen hat mich unglaublich geprägt“, sagte Richardi.
Als himmelschreiende Ungerechtigkeit hat er die Haltung der meisten Dachauer empfunden, die von den Verbrechen und den Opfern nichts wissen wollten. Richardi wollte den ehemaligen Gefangenen eine Stimme geben. „Ich war in Dachau allein.“ Andere warfen ihm vor, was er denn als Berliner da in der Dachauer Geschichte herumstochere. Richardi erhielt Drohanrufe, seine Frau wurde auf der Straße beschimpft. Auch die Politik schaltete auf Abwehr. Der damalige Bürgermeister Lorenz Reitmeier glaubte, die NS-Geschichte der Stadt wird in Vergessenheit geraten, wenn er nur lange genug das „andere Dachau“ der Künstlerkolonie propagierte. Aber auch mit der KZ-Gedenkstätte, die vielen Anfeindungen ausgesetzt war, stand Richardi immer mal wieder im Streit. Es ging um die Deutungshoheit in geschichtlichen Fragen – und in diesem Zusammenhang darum, dass Richardi, der den Zeitgeschichtsverein „Zum Beispiel Dachau“ gegründet hatte, als zu unkritisch gegenüber der Stadtpolitik angesehen wurde.
Statt Offizier wurde er Journalist
Kurs halten, das hatte Richardi, als er noch keine 20 war, bei der Marine gelernt. Er wollte Offizier werden, kam zum „3. Schnellbootgeschwader“ nach Flensburg und glitt mit dem Schnellschiff Jaguar über das Meer. Richardi, Sohn eines Baumeisters, der 1948 im russischen Kriegsgefangenenlager starb, musste aber bald die Schifffahrt aufgeben, weil er stark kurzsichtig war. Er wurde Journalist und volontierte 1961 in München beim 8-Uhr-Blatt, dem Vorgänger der Abendzeitung. Später wechselte er über eine Station beim Münchner Merkur zur Süddeutschen Zeitung, wo er bis zu seinem Ruhestand 2002 als Redakteur arbeitete und sich vor allem mit Themen der Zeitgeschichte beschäftigte.
Nach Beginn seines Ruhestands recherchierte er das Schicksal der 37 Sippen- und 98 Sonderhäftlinge aus 17 verschiedenen europäischen Ländern, die bei Kriegsende von der SS als Geiseln nach Niederndorf im Hochpustertal verschleppt worden waren. In der Folge gründete er das „Zeitgeschichtsarchiv Pragser Wildsee“. Er schrieb auch den „Dachauer Zeitgeschichtsführer“, ein Standardwerk. Die Aufnahme der KZ-Gedenkstätte in einen Stadtführer war Ende der 1970er Jahre in Dachau bahnbrechend.
„Er war ein kämpferischer Zeitgeschichtsforscher“
„Vor dem Hintergrund der solcherart lange Zeit sehr polarisierten Situation in Dachau hat Hans-Günter Richardi auf diese Weise große Verdienste dafür, dass sich die Stadt mittlerweile als Lernort begreift, zahlreiche entsprechende Aktivitäten unternimmt oder unterstützt und sich das Klima hinsichtlich der so schwierigen Geschichte nachhaltig verändert hat“, schreibt Jürgen Müller-Hohagen, Vizepräsident der Lagergemeinschaft Dachau, in deren Präsidium Richardi früher vier Jahre lang wirkte. Richardi erhielt viele Ehrungen in Frankreich, Italien und Deutschland. Zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes im Jahr 2022 sagte Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD): „Erinnern ist Arbeiten für die Zukunft, mit Ihrem Lebenswerk haben Sie sehr viel für uns als Gesellschaft heute, aber auch für die kommenden Generationen geleistet.“
Müller-Hohagen würdigt Hans-Günter Richardi so: „Er war ein kämpferischer Zeitgeschichtsforscher, der manchmal auch polarisiert hat. Dabei war er immer bereit, seine Erfahrungen und sein Wissen selbstlos anderen zur Verfügung zu stellen. Sein allergrößtes Anliegen lag darin, der von der SS betriebenen völligen Anonymisierung und Entmenschlichung der ihr ausgelieferten Häftlinge mit allen Kräften entgegenzuwirken. Durch seine unermüdliche Arbeit hat er auf diese Weise viele Häftlinge, ermordete wie auch überlebende, aus dem weitgehenden gesellschaftlichen Vergessen herausgeholt.“
Am 25. April ist Hans-Günter Richardi gestorben, vier Tage vor dem 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau.