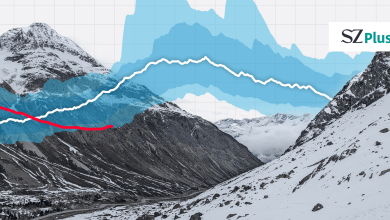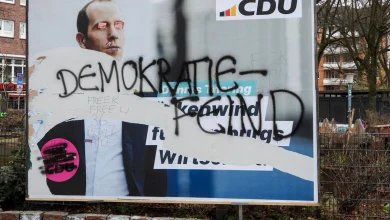Literaturnobelpreisträger Mario (*89*) Llosa mit 89 Jahren gestorben | ABC-Z

Das Jahr 1982 war ein wundersames für die lateinamerikanische Literatur. Gabriel García Marquéz bekam den Nobelpreis zugesprochen, und Isabel Allende brachte ihren Debütroman „Das Geisterhaus“ heraus, der zum weltweit größten Literaturphänomen aus diesem Kontinent seit dem fünfzehn Jahre zuvor erschienenen „Hundert Jahre Einsamkeit“ ebenjenes García Marquéz wurde. Kein wundersames Jahr war es dagegen für den Schriftsteller, der mit diesen beiden fortan das Dreigestirn der lateinamerikanischen Literatur darstellen sollte: Mario Vargas Llosa. Dieselbe Ehre wie García Marquéz ereilte ihn erst 2010, einen Welterfolg wie „Das Geisterhaus“ erlebte er nie. Trotzdem war er der Selbstbewussteste der drei.
Biographisch lag er zwischen seinen beiden Konkurrenten: Vargas Llosa wurde 1936 in Peru geboren, neun Jahre nach dem Kolumbianer García Marquez, sechs Jahre vor der Argentinierin Allende. Sein Debüt erschien 1959, eine Erzählungssammlung, aber der internationale Erfolg setzte erst vier Jahre später ein, mit dem Roman „Die Stadt und die Hunde“. Da lebte Vargas Llosa schon in Paris, der Stadt, die zu seiner wahren Heimat werden sollte – und ihm spät eine Ehrung bescherte, die ihn stolzer machen sollte als der Nobelpreis, weil er der Erste war, dem sie widerfuhr: die Aufnahme in die Académie française als erster nicht-französischsprachiger Autor, 2021.
Der Mann des totalen Romans
Peru war zu klein für diesen Mann, auch wenn er sich in seiner Heimat 1990 um das Amt des Staatspräsidenten beworben hatte. Vargas Llosa verstand sich immer auch als weltpolitischer Akteur, weshalb er seine Kolumne in der Tageszeitung „El País“, der wichtigsten der spanischsprachigen Welt, so lange führte, wie es eben ging: bis 2024, und es passte, dass er dann auch gleich verkündete, keine Romane mehr zu schreiben. Auf zwanzig hatte er es da mittlerweile gebracht, und sie waren in alle gängigen Sprachen übersetzt worden, fünf davon auch verfilmt, am erfolgreichsten 1991 „Julia und ihre Liebhaber“ nach dem schon anderthalb Jahrzehnte vorher erschienenen Roman „Tante Julia und der Kunstschreiber“.
Es ist bezeichnend, dass es sich dabei um eine Komödie handelte, die durch ihre Leichtigkeit überzeugte, während Varga Llosa in den Sechzigerjahren noch das selbsterfundene Konzept des „totalen Romans“ verfolgt hatte, mit dem so viele Aspekte der Realität abgebildet werden sollten, dass gerade aus dieser Mimesis heraus ein in sich schlüssiges Bild einer eigenen Welt entstehen sollte. Mit anderen Worten: Nur jemand, der von allem etwas verstand, konnte ein Romancier im Sinne von Varga Llosa werden. Beispiele dafür waren ihm Tolstoi und Thomas Mann.
Vom ehemaligen politischen Hoffnungsträger
Den Gipfel seiner Popularität erreichte Vargas Llosa aber nicht mit den nach diesem Anspruch gearbeiteten frühen Romanen, sondern 1987 mit „Der Geschichtenerzähler“. Und das ist das Buch aus seinem umfangreichen Schaffen, mit dem er tatsächlich Neuland betrat, denn damit widmete er sich als einer der ersten Schriftsteller und vor allem als der erste wirklich bekannte den indigenen Kulturen Lateinamerikas. Die Präsidentschaftskandidatur von 1990 erwuchs aus diesem Interesse, und tatsächlich war Vargas Llosa damals ein internationaler Hoffnungsträger für das krisengeschüttelte Peru, aber sein literarischer Ruhm reichte nicht für die Durchdringung der alten Eliten seiner Heimat. In den Folgejahrzehnten rückte der Schriftsteller dann politisch immer weiter nach rechts.
Vargas Llosa hat an seinen eigenen Literatur- und Machtansprüchen gelitten, auch was sein Privatleben anging. Der angekündigte Rückzug vom Schreiben im vergangenen Jahr wurde deshalb auch als ein Abschied vom Leben gedeutet. Am gestrigen Sonntag ist Mario Vargas Llosa nun gestorben, wie seine Familie bekanntgegeben hat, in der peruanischen Hauptstadt Lima mit neunundachtzig Jahren.