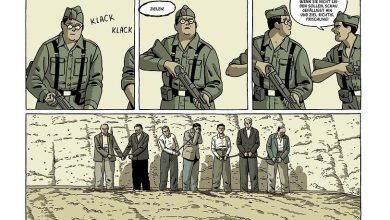Wind-Offshore-Auktion endet ganz ohne Gebote | ABC-Z

Für die Versteigerung zweier Flächen in der Nordsee, auf denen Offshore-Windparks mit einer Kapazität von 2,5 Gigawatt entstehen könnten, hat kein einziger Investor ein Gebot eingereicht. Damit ist zum ersten Mal solch eine Auktion in Deutschland gescheitert. Noch im Jahr 2023 waren aufsehenerregende Gebote über 12,6 Milliarden Euro für Flächen für sieben Gigawatt erzielt worden. Seither waren die Investoren deutlich zurückhaltender geworden. Nur noch ein Bruchteil früherer Werte wurde bei der Auktion im Juni erzielt, als Total Energies den Zuschlag für einen Ein-Gigawatt-Windpark mit einem Gebot von 180 Millionen Euro erhielt.
Die Branche ist entsprechend alarmiert. Von einer „Katastrophe“ spricht Stefan Thimm, Geschäftsführer des Bundesverbands der Windenergie Offshore (BWO), von einem „Scheitern mit Ansage“. „Die Branche warnt seit Jahren davor, den Unternehmen zu viele Risiken aufzubürden“, ärgert er sich. Schon zu Zeiten, als noch CDU-Politiker Peter Altmeier verantwortlich für den Ausbau der Offshore-Windenergie war, habe man das thematisiert. „Das Ergebnis ist ein klares Signal: Der deutsche Offshore-Wind-Markt ist für Investoren derzeit nicht interessant.“ Auch Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Energie und Wasserwirtschaft (BDEW), verweist darauf, dass die Risiken für Offshore-Windpark-Entwickler in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen haben. Eine umfassende Reform der rechtlichen Regeln sei dringend erforderlich, um die Ausbauziele zu erreichen.
Als großes Problem für Investoren gilt die Tatsache, dass sie Entscheidungen von großer Tragweite treffen müssen, während die Umstände immer volatiler werden. Dies gilt sowohl in Bezug auf die Errichtungskosten für einen Windpark, wo Lieferketten-Engpässe und geopolitische Spannungen einen großen Einfluss haben, als auch mit Blick auf die Strompreise, die eines Tages erzielt werden können. Das in Deutschland praktizierte, rein marktbasierte Ausschreibungsdesign müsse entsprechend angepasst werden, fordern die Offshore-Organisationen. Als ein möglicher Ausweg gilt ein zweiseitiger Differenzvertrag: Hier wird ein Investor, der sein Angebot auf der Grundlage seiner Kosten kalkuliert, bei niedrigen Strompreisen abgesichert, während sehr hohe Strompreise abgeschöpft werden.
Unterdurchschnittliche Windausbeute erwartet
Auch die mögliche Windausbeute spielt eine große Rolle für die Rendite eines Parks – und im aktuellen Fall dürfte das Argument durchaus relevant gewesen für die Zurückhaltung der Investoren. So sind nach Berechnungen des Fraunhofer IWES auf den Nordsee-Flächen N-10.1 und N-10.2, die jetzt zur Versteigerung standen, weniger als 3000 Volllaststunden im Jahr möglich. Auf vielen anderen Flächen vor den deutschen Küsten können bis zu 4500 Volllaststunden pro Jahr erreicht werden, was die Wirtschaftlichkeit erheblich beeinflusst.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) führte das Scheitern auf zwei wesentliche Ursachen zurück. Das ausgeschriebene Gebiet sei aufgrund seiner geologischen Bedingungen mit höheren Risiken behaftet, was zu entsprechenden Aufschlägen bei den Bietern führe. Zudem seien Kunden bei Stromabnahmeverträgen in Zeiten von Negativpreisen nicht mehr bereit, diese zu erfüllen, was den gesamten Finanzierungsplan eines Projektes infrage stelle. „Es wäre sicherlich gut, wenn die Bundesnetzagentur einen Blick über den Kanal wirft und gegebenenfalls die Ausschreibungsbedingungen anpasst“, sagte Reiche mit Verweis auf Großbritannien, wo in einem ähnlichen Fall das Verfahren nachgeschärft worden sei.
Die beiden Flächen wurden durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie bezüglich Meeresumwelt und Bodenbeschaffenheit voruntersucht, wofür Investoren insgesamt 47 Millionen Euro hätten zählen müssen. Für die größere der beiden Flächen ist eine Netzanbindung für das Jahr 2031 vorgesehen. Sie hat eine Kapazität von 2000 Megawatt, was etwa zwei Atomkraftwerken entspricht. Für die andere Fläche mit 500 Megawatt Leistung ist die Netzanbindung zusammen mit dem Windpark Waterekke im Jahr 2030 vorgesehen. Die beiden Windparks grenzen an die Fläche SEN-1, auf der die Produktion von klimafreundlichem Wasserstoff vorgesehen ist.
Deutschland plant, bis zum Jahr 2045 Offshore-Windparks mit insgesamt 70 Gigawatt zu errichten; ein Ziel, das auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung bekräftigt wurde. Ende Juni 2025 waren insgesamt 1639 Offshore-Windenergieanlagen mit 9,2 Gigawatt in Deutschland ans Netz angeschlossen. Für weitere Projekte über 3,6 Gigawatt liegen finale Investitionsentscheidungen vor. Zudem gibt es den Zuschlag für Projekte mit einer Leistung von zusammen 17,5 Gigawatt, die aber noch nicht in Auftrag gegeben wurden, wie einer Zusammenstellung des Beratungsunternehmens Deutsche Wind-Guard im Auftrag der Offshore-Branchenorganisationen zu entnehmen ist.