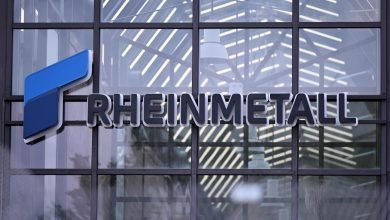Wie Warken das Milliarden-Loch in der Krankenversicherung stopfen will | ABC-Z

Die Bundesregierung will alles daransetzen, damit die Krankenkassenbeiträge weder 2026 noch 2027 steigen. Die Koalition schnüre derzeit ein Paket, um die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben von vier Milliarden Euro im kommenden Jahr zu schließen, sagte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) am Freitag in Berlin während der Vorstellung einer neuen Kommission zur Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
„Eine Lösung ist, mehr Mittel aus dem Haushalt zu bekommen“, sagte sie. „Wenn uns das nicht gelingt, muss auch über andere Maßnahmen nachgedacht werden, die Einspareffekte haben, vielleicht auch über einen Mix aus beidem.“
Zuvor hatte der Fraktionschef der Union im Bundestag, der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), angekündigt: „Entweder wird der Bundeszuschuss erhöht aus dem Haushalt – also Steuermittel –, oder es kommt zu kurzfristigen Spargesetzen.“ Der bisherige Bundeszuschuss beträgt 14,5 Milliarden Euro im Jahr. Warken sagte, die Koalition sei sich einig, die Beiträge stabil halten zu wollen, und stellte eine baldige Einigung in Aussicht: „Ich bin optimistisch, dass wir zu guten Lösungen kommen werden.“
„Nur die Spitze des Eisbergs“
Die Zeit dränge, da die Zusatzbeiträge für 2026 schon bald festgelegt werden müssten. Tatsächlich tagt der sogenannte Schätzerkreis zu den GKV-Finanzen schon am 15. Oktober. Bis zum 1. November muss Warkens Haus dann den rechnerischen durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2026 festlegen. 2025 gab es dabei laut Schätzerkreis bereits einen Rekordanstieg um 0,8 Prozentpunkte von 1,7 auf 2,5 Prozent. Tatsächlich erheben die Kassen aber im Mittel 2,9 Prozent, wie Warken am Freitag klarstellte.
Seit dem Jahr 2021 habe der Anstieg 1,6 Punkte betragen, was einer Mehrbelastung der Beitragszahler in vier Jahren von 30 Milliarden Euro entspreche. Mit einem Seitenhieb auf ihren Vorgänger Karl Lauterbach (SPD) sagte die Ministerin: „Ich habe das System in tiefroten Zahlen übernommen.“ Den Zusatzbeitrag erheben die Kassen individuell. Er ist zusätzlich zum allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent auf das versicherungspflichtige Bruttoeinkommen zu entrichten. Die Abgaben teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Die neue Kommission soll die GKV-Beiträge von 2027 an konstant halten, denn die derzeitige Vier-Milliarden-Deckungslücke sei nur „die Spitze des Eisbergs“, warnte Warken. Für 2027 sieht sie mindestens zehn Milliarden Euro voraus, wenn die Politik nicht umsteuere: „Die finanzielle Situation sieht für die kommende Jahre weitaus dramatischer aus, schon ab 2027 rutschen wir dann bei dem Defizit in den zweistelligen Milliardenbereich.“
Kritik der Arbeitgeber an der Reformkommission
Diese Spirale steigender Abgaben wolle die Koalition durchbrechen, um Arbeitgeber und -nehmer nicht zu überfordern. „Die zumutbaren Belastungen haben langsam, aber sicher ihre Grenze erreicht“, so Warken. „Wir müssen im Gesundheitswesen mit den Einnahmen wirtschaften, die vorhanden sind, und gleichzeitig eine Versorgung auf gutem Niveau und flächendeckend sicherstellen.“
Die neue „Finanzkommission Gesundheit“, die sich am 25. September konstituiert, werde dafür sorgen, das System auf ein „zukunftsfestes Fundament“ zu stellen, versprach Warken. „Alle Versorgungsbereiche müssen auf den Prüfstand, sämtliche Ausgaben und Einnahmen.“ Das Gremium soll im März 2026 erste Vorschläge zur Stabilisierung der GKV-Beiträge vorlegen. Ende 2026 sind in einem zweiten Schritt Empfehlungen zu längerfristigen „strukturellen Anpassungen“ geplant, um das „enorme Ausgabenwachstum der letzten Jahre nachhaltig zu reduzieren“, wie Warken sagte. Dem paritätisch von Frauen und Männern besetzten Kreis gehören zehn Wissenschaftler an. Darunter sind die Hamburger Rechtsprofessorin Dagmar Felix, der Medizinprofessor Ferdinand Gerlach aus Frankfurt, der Bielefelder Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner, die Medizinethikerin Eva Winkler aus Heidelberg sowie die Bayreuther Ökonomin Amelie Wuppermann.
Der ebenfalls beteiligte Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing sagte auf der Pressekonferenz mit Warken, die Fragestellung der Kommission sei „denkbar schwierig“. Es gebe im Gesundheitswesen ein „systemisches Problem, dass die Einnahmen nicht im gleichen Ausmaß wachsen wie die Ausgaben“. Diese Schere öffne sich immer weiter. Um das zu ändern, müssten viele Ansätze durchdacht werden, sagte Thüsing. Er paraphrasierte die christliche Jahreslosung für 2025 des Apostels Paulus: „Es braucht die Prüfung von allem und das Behalten des Guten.“
Warken: Keine Denkverbote
Thüsing geht es darum, Ansätze zu finden, die einerseits Wirksamkeit versprächen und andererseits zumutbar und politisch vermittelbar seien. Vermutlich werde es eine Mischung aus Schritten geben, um die Finanzierbarkeit zu verbessern. „Ich bin frohgemut, dass wir es schaffen, Antworten zu präsentieren. Das werden vielleicht keine bequemen Antworten sein, aber um bequeme Antworten sind wir auch nicht gebeten worden.“ Warken und Thüsing versicherten beide, es gebe für die Kommissionsarbeit keine politischen Vorgaben oder Denkverbote.
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA kritisierte, dass entgegen dem Koalitionsvertrag die Sozialpartner nicht an dem Gremium beteiligt seien. „Schließlich finanzieren vor allem Arbeitgeber und Beschäftigte mit ihren Beiträgen die gesetzliche Krankenversicherung“, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. „Es muss zentral darum gehen, den Anstieg der Beitragssätze und damit den Nettoklau bei den Beitragszahlenden zu beenden.“