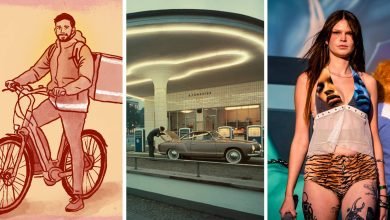Wie Russland mit dem Messenger „Max“ auf Handys mitliest | ABC-Z

Überwachung hat in Russland viele Gesichter, eines davon gehört Darja Sotejewa. Die 25 Jahre alte Social-Media-Figur aus dem Moskauer Umland ist eine der prominenten Stimmen, die für eine neue Anwendung namens „Max“ werben, die als „nationaler Messenger“ die ausländischen Marktführer Whatsapp und Telegram verdrängen soll. Anfang Juli sah man Instasamka, wie sich Sotejewa nach der Abkürzung für die amerikanische Plattform Instagram und dem russischen Wort für Weibchen nennt, in einem Werbeclip in einem gekachelten Raum. Stark geschminkt und mit Silberketten um den Hals schwärmte sie davon, dass Max „sogar im Parkhaus“ funktioniere.
Die Stabilität der Verbindung ist derzeit sensibel in Russland, im Angriffskrieg gegen die Ukraine drosseln die Machthaber das Internet regelmäßig oder schalten es ganz ab. Entsprechend lobte eine andere russische Influencerin, dass die Verbindung mit Max „sogar im Aufzug“ bestens sei, und ein Musiker begann einen Videoclip mit Aufnahmen von sich in einem Schlauchboot und der Aussage an einen „Bro“, Max empfange „sogar auf See“.
Alle Fäden laufen zu Putins Sicherheitsapparat
Als Entwickler des Messengers tritt das russische soziale Netzwerk VKontakte (VK) auf, das einst der IT-Unternehmer Pawel Durow lancierte. 2014 wurde er aus dem Unternehmen gedrängt, das heute über den Gazprom-Konzern und Präsident Wladimir Putins Vertrauten Jurij Kowaltschuk vom Machtapparat kontrolliert wird. Als Chef von VK fungiert seit vier Jahren Wladimir Kirijenko, der Sohn von Sergej Kirijenko, der seinerseits Putins Herrschaft über Russland und die annektierten ukrainischen Gebiete organisiert.
Putins Sicherheitsapparat kann auf die Daten von VK zugreifen – und damit auch auf Inhalte, die über Max ausgetauscht und auf den Servern des Unternehmens gespeichert werden. Das wird nicht versteckt. Die App bietet, anders als das zum amerikanischen Meta-Konzern zählende Whatsapp und die in Dubai ansässige Durow-Gründung Telegram, keine Nachrichtenverschlüsselung. Max’ Geschäftsbedingungen stellen klar, dass man Daten mit den Sicherheitskräften teile, wenn auch nur der Verdacht eines Rechtsverstoßes bestehe.
Dabei ist es in Russland jetzt schon verboten, „extremistisches“ Material online aufzurufen, was etwa Inhalte umfasst, die für die Ukraine, für LGBT und gegen Korruption eintreten. Kontrolle soll auch gewährleisten, dass Max nur nutzen kann, wer sich mit einer russischen oder belarussischen Mobilnummer anmeldet. Bürger beider Länder müssen für den Erwerb einer SIM-Karte den Pass vorlegen. Für Ausländer gelten noch strengere Regeln.
Nur mit VPN
Als eine kremlnahe Zeitung Ende März die neue VK-Entwicklung vorstellte, war die Rede von einem russischen Äquivalent zu WeChat, Chinas staatlich kontrolliertem Messenger, der unter anderem auch ein Zahlungssystem hat und Nutzern ermöglicht, Taxis zu rufen und staatliche Dienstleistungen zu erhalten. Fachleute bezweifelten seinerzeit, dass Max so verbreitet werde wie Whatsapp und Telegram, die derzeit in Russland laut dem Dienst Mediascope jeden Monat 97 Millionen respektive 90 Millionen Menschen nutzen.
Schon blockiert sind andere Dienste wie Signal und damit nur noch über den Umweg eines VPN nutzbar; solche „virtuellen privaten Netzwerke“, die in Russland auch nötig sind, um Zigtausende gesperrte Websites aufzurufen, dürfen nach einem neuen Gesetz zwar nicht mehr beworben werden, sind aber bisher nicht verboten. Neben dem Aufwand führt die faktische Ächtung aber schon jetzt dazu, dass viele Russen keine VPN-App installieren.
Erst mit politischem Druck begann Max’ Erfolg. Anfang Juni wurde der Messenger mit einem Gesetzentwurf für einen „nationalen, multifunktionalen Informationsaustauschdienst“ verbunden. Kurz darauf ließ Putin seinen Informationsminister in einer Regierungssitzung zur „Gewährleistung der technologischen Souveränität im Bereich der Kommunikationsdienste“ referieren.
Maxut Schadajew lobte Russlands staatlich kontrollierte Angebote wie VK und die Suchmaschine Yandex. Er kritisierte „ausländische“ IT-Konzerne, die sich nach dem „Beginn der SWO“ – so das russische Kürzel für die „spezielle Militäroperation“, den Krieg gegen die Ukraine – 2022 „gänzlich destruktiv“ gegenüber russischen Nutzern verhalten hätten.
Im März jenes Jahres hatte Moskau den Meta-Konzern, dem neben Whatsapp auch Instagram und Facebook gehören, als „extremistisch“ verboten und die beiden Plattformen in Russland blockiert, nur den Messenger unbehelligt gelassen. Leute wie Sotejewa stört das kaum: Instasamka folgen auf Instagram, für dessen Nutzung ein VPN nötig ist, mehr als fünf Millionen Profile.
Offenkundig umgehen auch Putins Funktionäre die Sperren, wenn sie insbesondere die in Russland seit 2022 ebenfalls blockierte Plattform X, das frühere Twitter, nutzen, um nach Westen zu wirken. Auf Facebook und Instagram dürfen russische Unternehmen seit Anfang dieses Monats keine Werbung mehr schalten.
Die zu Google gehörende Videoplattform Youtube wird seit Juli vorigen Jahres so stark verlangsamt, dass sie sich ohne VPN kaum mehr nutzen lässt. Funktionäre wie Schadajew und die Medienaufsicht Roskomnadsor rügen dabei stets Verstöße gegen russische Gesetze; dahinter steht aber die Frage nach der Kontrolle über die Informationen, welche die Russen erreichen, und über die Nutzerdaten.
Was ist mit Telegram?
Während schon seit Langem klar ist, dass der Kreml die amerikanischen Angebote verdrängen will, war die Haltung der Machthaber gegenüber Telegram lange unklar: Nachdem vor sieben Jahren erste Blockadeversuche gegen den Dienst gescheitert waren, hatten Putins Macht- und Medienvertreter selbst erfolgreich damit begonnen, Durows Messenger und insbesondere dessen Kanäle zu nutzen. Im Krieg gewannen prorussische Militärblogger dort ein Millionenpublikum.
Im Juli 2023 bezeichnete ein Vertreter von Putins Präsidialverwaltung Telegram als „bedingt russisch“, jedenfalls „nicht feindlich“. Nun jedoch stellte Schadajew allgemein als Problem dar, dass „ausländische Messenger“ in Russland die beliebtesten seien, und warb unter Hinweis auf Länder wie China für den „vollkommen russischen Messenger“ von VK. Putin wies seine Regierung an, das Vorhaben zu unterstützen, das sei „außerordentlich wichtig“, und unterzeichnete Ende Juni das eilends verabschiedete Gesetz.
Jetzt sind seine Funktionäre gehalten, über Max zu kommunizieren und Kanäle dort einzurichten. Diese sind vielfach von den Telegram-Auftritten kopiert. Nutzer kritisierten die Anwendung wegen technischer Mängel, der fehlenden Möglichkeit, Beiträge negativ zu bewerten, und der Überwachung: Max sammele zu viele Daten, zu Standort, Kamera, Mikrofon, Kontakten, Anrufgeschichte. Sogar regimetreue Russen sehen Sicherheitsrisiken, wenn man eines Tages über Max wirklich, wie geplant, Bankgeschäfte tätigen, Reisen buchen und den Gang zur Behörde ersetzen können sollte.
Doch die Machthaber erhöhen den Druck, die App zu installieren, immer mehr. An Moskauer Schulen sind Elternchats seit Beginn des neuen Schuljahres über Max zu führen. Die App muss auf neu verkauften Smartphones vorhanden sein, auch wenn es daran noch hapern soll. Entscheidendes Mittel aber ist, dass die Hauptwettbewerber geschwächt werden: Seit Ende Juni gab es Störungen bei Whatsapp und Telegram, Mitte August hat Roskomnadsor die Anruffunktionen bei beiden Apps blockiert, wobei man sich auf betrügerische und terroristische Umtriebe berief.
Die Berichte über die Blockade nutzte das Staatsfernsehen, um für Max zu werben; es war dabei zwar viel von Sicherheit die Rede, doch nie von einer der Russen vor dem Staat, der sie etwa wegen Social-Media-Posts jahrelang in Haft nehmen kann, was in der Praxis oft aufgrund von Beiträgen auf VK erfolgt. Vielmehr ging es um Sicherheit dank des Staates, der sich der „ausländischen“ Messenger entledige und Betrügern den Kampf ansage. Indes sind schon Fälle bekannt geworden, in denen auch Max-Nutzer über Anrufe dazu gebracht worden, Betrügern Geld zu geben.
Von einer Million Nutzer zu 30 Millionen
Wer wie bisher über Whatsapp und Telegram telefonieren will, braucht nun ein VPN. Viele Russen verabreden sich und schalten den Umweg erst zum Gespräch ein, denn er kann die Verbindung verlangsamen, zudem lassen sich viele russische Dienste nicht mehr nutzen. Vermutet wird, dass bald auch die Chatfunktionen von Telegram und Whatsapp blockiert werden. Putins Mix aus Reklame, Druck und Zwang scheint zu fruchten: Meldete VK zu Beginn der Max-Werbekampagne eine Million Nutzer, sollten es Anfang September schon mehr als 30 Millionen sein.
Es gibt aber auch Gegenreaktionen. Gegenüber dem Soziologie-Projekt Russian Field lehnten es im August 70 Prozent der befragten Russen ab, wegen Max nun Whatsapp zu blockieren, eine Telegram-Blockade lehnten 71 Prozent ab. Ein satirischer Clip, der auf Telegram kursiert, zeigt einen angeblichen Max-Entwickler, der nebenbei als Taxifahrer arbeitet, wie er drei weibliche Passagiere mit intimen Details aus deren Leben verblüfft.
Viele Russen suchen nach Alternativen, haben etwa die App Google Meet installiert. Doch auch hier gibt es nun Störungen, für die Roskomnadsor bisher die Verantwortung abstreitet. Das exilrussische Newsportal Medusa berichtete, sogar Putins Funktionäre wichen nun auf den Apple-Dienst FaceTime aus oder auf wenig bekannte Messenger wie Zangi. Unabhängige Fachleute raten davor ab, das „trojanische Pferd“ Max zu installieren – und sollte es doch nötig werden, dann auf einem gesonderten Smartphone, das ausschließlich zu diesem Zweck benutzt wird.
Noch stärker von den Kontrollbestrebungen des Staates betroffen sind die zahlreichen Arbeitsmigranten aus früheren Sowjetrepubliken. In Moskau und dem Umland der Hauptstadt sind sie seit Anfang September Objekte eines „Experiments zur Erfassung des Aufenthaltsorts ausländischer Staatsbürger“ und müssen eine App namens Amina auf den Smartphones installieren, die ihre Bewegungen verfolgt.
Hervorgegangen ist sie aus einer Anwendung, die Covid-Infizierte einrichten mussten, um zu belegen, dass sie ihre Wohnung in der Isolationszeit nicht verließen. Amina soll eine in der Praxis oft komplizierte Meldepflicht ersetzen. Doch wer jetzt drei Tage lang keine Geodaten über die App übermittelt, gelangt in ein Register „kontrollierter Personen“ mit Einschränkungen etwa bei Bankgeschäften; im Wiederholungsfall droht Abschiebung.
Bisher hat die App technische Probleme, wer es geschafft hat, sie zu installieren, klagt, dass die ständige Geodatenübermittlung den Smartphoneakku schnell aufzehre. Aber der Dauerüberwachung soll die Zukunft gehören. In einem Jahr sollen noch mehr Ausländer, die nach Russland kommen, Amina installieren müssen.