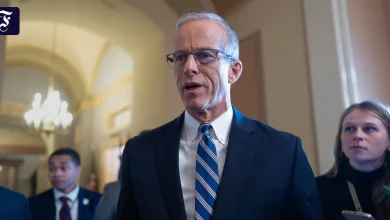Wie psychische Erkrankungen von Jugendlichen früher erkannt werden | ABC-Z

Emil war von Anfang an anders. Er schlief weniger als sein Bruder, war sehr früh motorisch und sprachlich sehr weit. Sein erstes Wort war nicht etwa Mama oder Papa, erinnert sich seine Mutter Alix Puhl: „Es war Blackberry.“ Als Emil älter wurde, war er ein stilles Kind, baute Türme im Sandkasten, während andere Fußball spielten. „Es waren alle froh, dass er so still war und keinen Ärger gemacht hat“, sagt sie. Auch in der Grundschule hatte er „normale“ Noten, weder besonders toll noch besonders schlecht. Er könnte mehr Sozialkontakte haben, stand einmal in einem Zeugnis, aber er hatte ein paar Freunde. Deswegen habe keiner darauf geachtet. „Wir sind damals gar nicht auf die Idee gekommen, dass etwas wirklich anders ist“, sagt die Mutter. Wenn sie heute an die vielen Eigenarten Emils denkt, wie etwa, dass er als Kind nur eine ganz bestimmte Jacke tragen wollte oder lange nur ein bestimmtes Fahrrad gefahren ist, weiß sie: Das waren alles Puzzlestücke, die ihr Mann und sie nicht zu dem Bild einer Autismus-Spektrum-Störung zusammensetzen konnten.
Mit 13 Jahren lernte Emil Japanisch, weil ihm die deutschen Übersetzungen von Animes und Mangas nicht gefielen. Er reiste mit seinem Vater Oliver Puhl nach Japan, teilte die Leidenschaft für das Land mit ihm. Schon bald legte er für sich fest, auf ein Internat in der Nähe Tokios zur Schule gehen zu wollen. „Ich glaube, wir haben unser Kind verloren“, schrieb Oliver Puhl nach der Besichtigung des Internats halb im Scherz seiner Frau. „Damals wusste ich natürlich nicht, dass wir wirklich unser Kind verlieren werden.“
Lange keine Diagnose, lange keine Erklärung
Eines Tages Ende Januar 2020 rief dann die Schulleitung aus Japan bei Familie Puhl an: Ihr Sohn sei suizidal. „Wir dachten erst, sie hätten die falsche Familie erreicht“, sagt Alix Puhl. Nach den Weihnachtsferien zu Hause in Frankfurt habe sich Emil noch „gefreut wie ein Keks“, nach Japan zurückzukehren, so habe es sein Vater wahrgenommen. Doch die Schulleitung irrte sich nicht. Also versuchten die Puhls schnellstmöglich, einen deutschen Therapeuten zu finden, der mit ihrem Sohn in Japan sprechen sollte. „Im Nachhinein muss man wirklich sagen, das war ein Scharlatan“, sagt Oliver Puhl. Aber sie waren in Not, hätten jeden genommen, der Zeit hat.
Zurück in Deutschland sprach Emil fast jeden Tag mit dem Therapeuten. Warum es Emil nicht gut ging, er sich quasi auflöste, „wie beim Beamen bei Raumschiff Enterprise“ beschreibt es Oliver Puhl, und warum Emil suizidale Gedanken hatte, erklärte der Therapeut den Puhls aber nicht. Eine Diagnose sei überflüssig, habe er gesagt. Dann teilte Emil seiner Mutter eines Tages mit, er werde sich das Leben nehmen. Weil sein Therapeut nicht erreichbar war, entschieden sich die Puhls, ihren Sohn gegen seinen Willen in die geschlossene Abteilung der Frankfurter Kinder- und Jugendpsychiatrie zu bringen.
Dort bekam Emil sehr spät die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung und einer dadurch zuletzt stark verschärften Depression. Eine Diagnose zu haben, sei hilfreich gewesen. „So hatten wir zumindest etwas, von dem wir sprechen konnten“, sagt Alix Puhl. Fünf Wochen blieb Emil in der Klinik. Seine Erkrankung überlebte er nicht, sechs Wochen später suizidierte sich Emil. Er wurde 16 Jahre alt.
Wo sie sich vorher allein gefühlt hatten und dachten, sie müssten Emils Erkrankung „unter dem Deckel halten“, wie Alix Puhl es ausdrückt, zeigte sich schnell nach seinem Tod: Viele Menschen haben eine ähnliche Geschichte erlebt, haben Freunde, Verwandte oder andere ihnen liebe Menschen durch einen Suizid verloren. „Unheimlich viele Menschen haben uns ihre Geschichten erzählt“, sagt Oliver Puhl. „Das war wirklich sehr hilfreich, dieses Gefühl: Ihr seid nicht allein.“
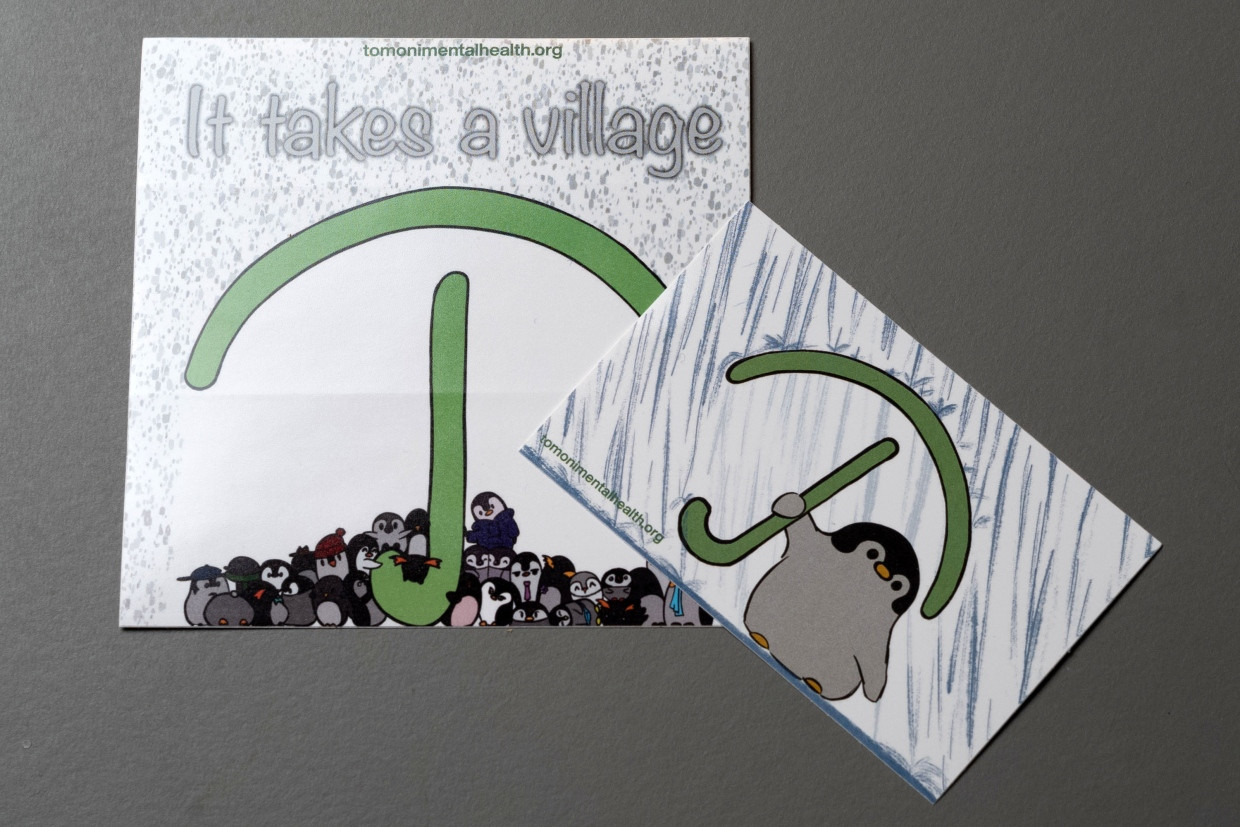
Viele der Menschen, die sich den Puhls geöffnet haben, hätten erzählt, dass sie noch nie vorher darüber gesprochen hätten. Da wurde den Puhls klar: Wir brauchen einen anderen Umgang mit dem Thema Suizid und mentale Gesundheit in der Gesellschaft. Also wollten sie etwas daran ändern und verhindern, dass es anderen Familien und Kindern so geht wie ihnen und Emil. Zwei Jahre später, im März 2022, gründeten sie Tomoni.
20 Prozent der Jugendlichen sind psychisch krank
Dabei wollten die beiden eigentlich gar nicht selbst unternehmerisch tätig werden. Zunächst wollten sie mit ihrer Puhl Foundation ein Projekt unterstützen, das sich mit dem Thema psychischer Erkrankungen im Jugendalter befasst. „Aber das war alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten“, sagt Oliver Puhl. Sie wollten etwas niedrigschwelliges, das für das erwachsene Umfeld der Kinder und Jugendlichen erreichbar ist.
Denn in Gesprächen mit den jungen Menschen habe sich herausgestellt, dass ihr gesamtes Umfeld auf psychische Erkrankungen und die besonderen Bedürfnisse der Betroffenen aufmerksam gemacht werden müsse. 90 Prozent aller Suizide sind die Folge einer psychischen Erkrankung – und in Deutschland sind 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen betroffen. 50 Prozent aller psychischen Erkrankungen beginnen bereits vor dem 15. Lebensjahr.
Von Wissenschaftlern lernten die Puhls, dass schon Anzeichen auch durch geschulte Laien gut erkennbar seien. Eigentlich könne jeder frühzeitig Erkrankungen entdecken und Betroffene früh dabei unterstützen, professionelle Hilfe zu erhalten – nicht nur, um Suizide zu verhindern.
Tomoni, was auf Japanisch „zusammen“ bedeutet, verfolgt einen krankheitsübergreifenden und digitalen Ansatz. So können sich zum Beispiel Eltern vom eigenen Sofa aus schulen, was besonders bei dem häufig noch immer schambehafteten Thema psychische Gesundheit hilfreich ist. Für Lehrer und Sporttrainer bietet Tomoni ebenfalls wissenschaftlich fundierte Fortbildungen und Informationsveranstaltungen. Und auch die Jugendlichen bekommen Tipps, wie sie auf die mentale Gesundheit ihrer Freunde achten können.
Ein Netzwerk von Experten unterstützen Tomoni
Unterstützt wird Tomoni dabei von einem großen Netzwerk: So sorgt etwa der wissenschaftliche Beirat dafür, dass klinische Erfahrungen und neueste Forschungsergebnisse in die Arbeit Tomonis einfließen. Der pädagogische Beirat mit Vertretern aller Schulformen stellt sicher, dass die Angebote praxisnah gestaltet werden, und Sorgeberechtigte können im Parents Circle ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Das Herzstück von Tomoni sind die Gamechanger: Jugendliche, die teils selbst Erfahrung mit psychischen Erkrankungen haben und die Initiative aktiv mitgestalten.
Damit Tomoni weiter dabei helfen kann, Suizide zu verhindern, bittet die F.A.Z. ihre Leser in diesem Jahr um Spenden für das Projekt. Das gemeinnützige Unternehmen aus Frankfurt will vor allem in ihre Mitarbeiter investieren, Angebote weiterentwickeln und das Projekt bekannter machen. Damit mehr junge Menschen die Chance haben, ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben zu leben.
Manche werfen den Puhls vor, mit Tomoni den Suizid ihres Sohnes „auszuschlachten“ oder damit „ihr Gewissen zu beruhigen“. „Wir werden uns sicher ein Leben lang vorwerfen, das wir unser Kind nicht im Leben halten konnten“, sagt Oliver Puhl. „Aber wir versuchen, weiterzuleben und etwas Gutes für andere zu machen.“
Wenn Emil an Krebs gestorben wäre, würde niemand etwas sagen, wenn wir uns für die Krebsfrüherkennung einsetzen würden, sagt Alix Puhl. Was die Leute über sie denken, ist den Puhls „total wurscht“. Um sie gehe es auch nicht, sondern um die Kinder und Jugendlichen.
Ob Emil heute noch leben würde, wenn Alix und Oliver Puhl damals schon so viel über psychische Erkrankungen gewusst hätten? Vielleicht, wissen können sie es nicht. Aber sie wissen, dass es ohne ihn Tomoni nie gegeben hätte. Sie wissen auch, dass sie mit Tomoni jungen Menschen mit psychischen Erkrankungen aktiv helfen können, das Leben zu leben, das sie verdienen. Und das sei das, was sie jeden Morgen aus dem Bett treibe, sagt Oliver Puhl.