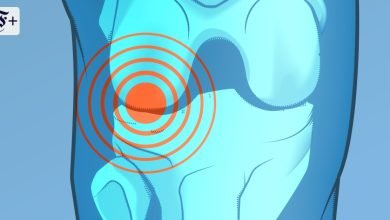Wie Opus Dei reich wurde | ABC-Z

Als das Schicksal der spanischen Bank Banco Popular im Sommer 2017 endgültig besiegelt wurde, war dies Europas Finanzmedien keine allzu große Berichterstattung wert. Die Bank, die an den Spätfolgen allzu leichtfertig vergebener Immobilienkredite kollabierte, war zwar die sechstgrößte Spaniens. Aber die Aufregung auf dem Kontinent hielt sich in Grenzen. Nicht zuletzt deshalb, weil der Banco Popular das erste europäische Geldhaus war, das nach der verheerenden Finanzkrise des Jahres 2008 nach neuen europäischen Regeln zur Bankenabwicklung in die Insolvenz ging – also erfreulicherweise, ohne den Steuerzahler zu belasten.
In Spanien war die Unruhe trotzdem groß. Viele Kunden der Bank ließen sich nicht dadurch besänftigen, dass der Konkurrent Santander das Institut am Ende zum symbolischen Preis von einem Euro übernahm. Und 300.000 Aktionäre mussten erleben, dass ihre Investition gewissermaßen über Nacht wertlos wurde. Hart traf es die vielen Kleinaktionäre, die die Bank aufgrund ihrer lokalen Verwurzelung hatte. Aber auch einige Großanleger zogen angesichts der horrenden Verluste vor Gericht.
Seltsam war nur, dass ausgerechnet der größte Anteilseigner, eine Investorengruppe mit dem Namen „La Sindicatura“, sich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht vernehmen ließ. Zu dieser Gruppe zählten unterschiedliche Investmentfirmen mit so wohlklingenden Namen wie „Europäische Union der Investoren“ oder „Fonds für internationale Entwicklung und Kooperation“. Ein genauerer Blick auf die Personen, die hinter diesen Fonds standen, förderte erstaunliche Übereinstimmungen zutage: Es handelte sich vorwiegend um eine gar nicht so große Gruppe spanischer Männer mittleren Alters. Die Tatsache, dass wegen ihrer Bank in Spanien die Hölle los war, dürfte diesen Männern zutiefst zuwider gewesen sein. Denn sie alle standen einer Organisation nahe, die sich von der Hölle so weit weg sieht, wie es auf Erden nur möglich ist: Es handelte sich um Anhänger des „Opus Dei“.
Eine verschworene Gemeinschaft
Normalsterblichen ist die erzkonservative katholische Gemeinschaft, deren lateinischer Name „Das Werk Gottes“ bedeutet, eher aus dem Kino bekannt: Die Verfilmung von Dan Browns Bestseller „The Da Vinci Code: Sakrileg“ aus dem Jahr 2006 zeichnet das Bild einer verschworenen katholischen Gruppe, die im Verborgenen agiert und dabei verstörend wirkenden Bräuchen folgt. Die regelmäßige Selbstgeißelung gehört dazu.
Vieles an der filmischen Darstellung darf als völlig übertrieben gelten. Aber richtig ist: Die 1928 vom Spanier Josemaría Escrivá (1902–1975) gegründete Organisation lässt sich noch immer ungern in die Karten schauen. Darum hat Opus Dei auch mit Ablehnung auf ein bisher nur auf Englisch erschienenes Buch reagiert, das jüngst insbesondere in Spanien für Furore gesorgt hat: In „Opus: Dark Money, a secretive Cult and its Mission to remake our World“ (Scribe-Verlag, 32 Euro) berichtet der Journalist Gareth Gore, wie es dazu kommen konnte, dass eine der wichtigsten spanischen Banken viele Jahrzehnte lang faktisch in den Händen des Opus Dei war.
100 Millionen Dollar von einer Bank
Die Beteiligung am Banco Popular, so stellt es Gore dar, hat den Aufstieg der Organisation sogar erst ermöglicht. Zeitweise sollen 100 Millionen Dollar jährlich aus der Bank an Opus Dei abgeflossen sein. Für den prächtigen Hauptsitz, die Villa Tevere im Herzen Roms, gab es über Jahre hinweg hohe Summen aus der Zentrale des Banco Popular. Das Geld half auch dabei, den Einfluss des Opus Dei in Übersee zu stärken, vor allem in den Vereinigten Staaten. So wurde aus einer in Spanien gegründeten Gruppierung, die lange nur wenige Hundert Mitglieder hatte, bis zum Ende des Jahrtausends eine weltumspannende Organisation.
Wie aber konnte es sein, dass eine börsennotierte Bank, die in Spanien so gut wie jedes Kind kannte, im Verborgenen zur wichtigsten Geldquelle für eine erzkatholische Organisation mit gewöhnungsbedürftigen Ritualen wurde?
Dies hat vor allem mit einem Spanier mit klingendem Namen zu tun: Luis Valls-Taberner wurde 1926 in Barcelona als Spross einer einflussreichen Familie geboren. Die Mutter war streng katholisch, der Vater ein bekannter Regionalpolitiker. Luis selbst sollte bald zu einem der angesehensten spanischen Bankiers aufsteigen, der sich fast 50 Jahre lang in unterschiedlichen Positionen an der Spitze des Banco Popular hielt. Zuvor hatte er sich allerdings schon im Alter von 19 Jahren jener Organisation verpflichtet, deren weltweiten Einfluss er bald überall mehren sollte, dem Opus Dei.
Valls-Taberner passte genau in den Kreis junger Leute, die Opus-Dei-Gründer Josemaría Escrivá für seine Organisation besonders interessant fand. Escrivá hatte es sich zum Ziel gesetzt, aus seinem Heimatland Spanien heraus die „Verchristlichung der Gesellschaft“ zu fördern, was bei ihm vor allem mit der Ablehnung vieler Entwicklungen der Moderne zu tun hatte. Er zeigte aber auch schon früh Tendenzen, die eher einer autoritär geführten Sekte glichen als einer christlichen Organisation. Für den Aufbau von Opus Dei wünschte er sich vor allem junge, zölibatär lebende Männer aus gutem Hause, die seine Führung nicht infrage stellten und die vorteilhafte Verbindungen mitbrachten. Denn diese Verbindungen, darauf hoffte der Opus-Dei-Gründer, ließen sich früher oder später zu Geld machen. Nichts war für den Aufstieg seiner Gemeinschaft wichtiger.
So gesehen war Luis Valls-Taberner der ideale Rekrut. Die Familie war wohlhabend, und mütterlicherseits hatte Luis enge Verbindungen zum Banco Popular. Gleich mehrere Verwandte arbeiteten dort in Führungspositionen. Einen Mann in den eigenen Reihen zu haben, der eines Tages Bankvorstand werden könnte, bot aus Sicht des Opus Dei eine hervorragende Perspektive.
Der Prozess des Anwerbens begann im Falle von Valls-Taberner im Jahr 1945 und hätte aus Sicht der Organisation nicht besser laufen können. Der Jurastudent ließ sich von einem älteren Bekannten ansprechen, der nach Gareth Gores Recherchen genau tat, was ihm der Opus-Dei-Gründer aufgetragen hatte. Er freundete sich mit Valls-Taberner an und entfremdete ihn mehr und mehr von seinem bisherigen Bekanntenkreis. Es half ihm, dass sich Valls-Taberner von der Ernsthaftigkeit und Kameradschaft der jungen Männer angezogen fühlte. Sie kamen regelmäßig an einem Ort in Barcelona zusammen, an dem sich auch der Opus-Dei-Gründer Escrivá häufig sehen ließ. Als streng katholisch erzogener Mensch fand der junge Luis nichts dabei, zu festgelegten Zeiten zu beten, und gewöhnte sich auch an die regelmäßigen Selbstzüchtigungen, die Escrivá seinen Anhängern abverlangte.
Es fehlte das Geld
Dass sich auch Menschen wie Valls-Taberner, die eher zur Oberschicht gehörten, in das strenge Regelwerk des Opus Dei einfügten, hatte in den Anfängen der Organisation viel mit dem besonderen Charisma des Gründers zu tun, schreibt Autor Gareth Gore in seinem Buch. Escrivá wurde damals in manchen Teilen Spaniens wie eine Heilsgestalt verehrt, auch Diktator Franco konsultierte ihn regelmäßig. Es schmeichelte jungen Leuten wie Valls-Taberner, dass Escrivá mit ihnen im regelmäßigen Austausch stand. Sie waren sogar bereit, einen Großteil ihrer Einkünfte der Organisation zu überlassen, wie es Escrivá von ihnen erwartete. Der Kontakt wurde enger, als Valls-Taberner seine Mutter zu einer ersten größeren Spende an Opus Dei überredete. Schon in dieser Zeit fiel dem jungen Mann auf, dass dem verehrten Gründer eines permanent zu fehlen schien – Geld.
Ein perfider Plan
So reifte in Luis Valls-Taberner ein Plan, den man je nach Sichtweise als gerissen oder als perfide bezeichnen kann. Er wollte den Banco Popular unter Kontrolle des Opus Dei bringen. Das Schicksal wollte es, dass ein Cousin seiner Mutter damals den Aufsichtsrat des Geldhauses führte. Luis hatte kompromittierendes Material gegen ihn in der Hand und zögerte nicht, es als Druckmittel einzusetzen. So kam es, dass der Cousin der Mutter ihm seine Bankanteile zu einem günstigeren Preis überließ. Zweifel überkamen den tiefgläubigen Christen bei dieser Erpressung wohl nicht. Er fühlte sich im Auftrag einer größeren Sache unterwegs.
Nachdem der erste Schritt gemacht war, baute Valls-Taberner seinen Einfluss in der Bank systematisch aus. Er wurde zur rechten Hand des Aufsichtsrates ernannt, was im Alter von 31 Jahren außergewöhnlich war. Über eine trickreiche Konstruktion schusterte er im Verbund mit einigen anderen Opus-Dei-Mitgliedern in der Bank seiner Organisation immer mehr Anteile zu: Er setzte durch, dass die Bank Kredite an einen Fonds vergab, der von Opus-Dei-Leuten geführt wurde. Mit diesen Krediten kaufte der Fonds später Anteile an der Bank. Mit anderen Worten: Die Bank finanzierte ihre eigene feindliche Übernahme durch Opus Dei gewissermaßen selbst. Das war grotesk und ging nur gut, weil es Valls-Taberner gelang, die Transaktion so kunstvoll zu verschachteln, dass sie nicht direkt auffiel. Opus-Dei-Gründer Escrivá nannte ihn spätestens von diesem Zeitpunkt an nur noch „mi Banquero“ („mein Bankier“).
Schon bald merkten die neuen Eigentümer allerdings, dass sie sich nicht alles erlauben konnten. Valls-Taberner war zwar inzwischen zum „Presidente“ aufgestiegen. Aber als er zu offensichtlich darauf drängte, bestimmte ihm nahestehende Organisationen mit besonders günstigen Krediten zu unterstützen, fiel dies in der Bank auf. Er nahm sich fortan zurück und stieg in Spaniens Finanzwelt bald zu einem der angesehensten Bankiers auf. Er hatte verstanden: Je besser das Geschäft lief und je besser er die Geschäfte führte, umso besser für Opus Dei.
In der Öffentlichkeit galt er als guter Geschäftsmann und guter Christ. Seine Zugehörigkeit zu Opus Dei war zwar bekannt, aber sie wurde ihm nicht negativ ausgelegt. In welchem Maße er durch die Bank die Sache seiner Organisation unterstützt hat, wurde ohnehin erst im Nachhinein öffentlich. Neben den Dividenden, die an „La Sindicatura“ flossen, waren dies Spenden in Millionenhöhe an vermeintlich mildtätige Einrichtungen, die alle Opus Dei nahestanden.
Luis Valls-Taberner hielt sich bis ins hohe Alter von 78 Jahren an der Spitze der Kontrollgremien des Banco Popular. Sein Abgang war für ihn selbst schmerzhaft: Sein Gedächtnis spielte nicht mehr mit, er hatte in aller Öffentlichkeit Aussetzer und war nicht mehr im Amt zu halten. Bald darauf starb er.
Für Opus Dei war das ein tiefer Einschnitt. Mit Valls-Taberner hatte die Organisation ihren wichtigsten Finanzier verloren. Einige Jahre flossen die Dividenden noch, bis der Banco Popular 2017 zusammenbrach. Es war das endgültige Ende einer Finanzbeziehung, wie sie die Welt zuvor noch nie gesehen hatte.