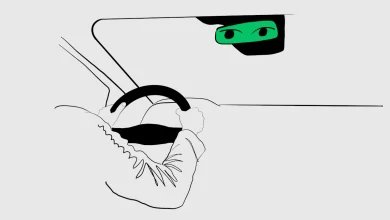Wie ETF-Anleger mehr Einfluss erhalten könnten | ABC-Z

In Aktien investieren, ohne zu zocken; Risiken streuen, ohne selbst einen Finger krumm zu machen – Millionen Deutsche schwören inzwischen auf diese Form der Geldanlage. Das Standardprodukt, das all diese Vorteile verspricht, ist der ETF. Der Clou der „Exchange Traded Funds“: Anleger investieren in einen Indexfonds, der zum Beispiel den Dax mit seinen 40 Großunternehmen nachbildet, ohne die enthaltenen Aktien einzeln kaufen zu müssen. Das geht mit ein paar Klicks am Handy, bringt in aller Regel gute Renditen und lässt Anleger ruhig schlafen. Also alles perfekt?
Oliver Hart sieht das nicht so. Er zweifelt zwar nicht daran, dass man mit ETF gutes Geld verdienen kann. Er sieht aber eine Schattenseite: Die vielen Millionen Kleinanleger, die Milliarden Euro investieren, bleiben auf den Hauptversammlungen der großen Konzerne stumm. Sie reden also nicht mit, wenn es darum geht, welche Ziele und Vorgaben Konzerne sich geben. Das sei fatal, weil die Konzerne dann tun und lassen könnten, was sie wollen – und das sei nicht immer das, was sich normale Menschen wünschen. „Unternehmen tun viel Gutes“, sagt Oliver Hart. „Sie tun aber auch viel Schlechtes.“
Oliver Hart ist kein Antikapitalist, er ist Wirtschaftsnobelpreisträger. Der Ökonom glaubt an Wettbewerb, finanzielle Anreize und das Gute im Menschen. Aber eben auch an das Schlechte in Unternehmen. Das wird deutlich, wenn er zum Beispiel über den Mineralölkonzern ExxonMobil spricht. „Exxon hat gegen CO2-Regulierung lobbyiert und Studien finanziert, die Zweifel am Klimawandel wecken. Das sind Fakten“, sagte Hart kürzlich während eines Vortrags in Lindau am Bodensee. Solche in seinen Augen verwerflichen Dinge zu tun, sei nicht im Interesse der Kleinanleger, die Firmen wie Exxon finanzieren. „Wir wollen reich sein, wir wollen aber auch andere Dinge. Zum Beispiel wollen wir und unsere Enkel nicht in einer noch heißeren Welt leben.“
Blackrock gehören die Aktien
Um das strukturelle Problem zu verstehen, das den Nobelpreisträger umtreibt, muss man etwas tiefer in die ETF-Logik einsteigen. Anleger, die in Indexfonds investieren, vertrauen ihr Erspartes Fondsunternehmen wie Blackrock oder Vanguard an, die dann die entsprechenden Aktien kaufen. Weil dieses Geschäft boomt, sind Blackrock und Vanguard zu den größten Investoren im Dax aufgestiegen.
Die Fondsgesellschaften, nicht die Privatanleger, üben dann in der Regel auf den Hauptversammlungen das Stimmrecht aus. „Die meisten Anleger haben keine Ahnung, dass das passiert“, sagt Hart. Die Fondsgesellschaften – Hart spricht von Intermediären – würden ihre Geldgeber kaum nach deren Meinungen zu Klimaschutz, Arbeitsbedingungen oder zum Kurs einzelner Unternehmen befragen. Blackrock hat vor einigen Jahren zwar ein Beteiligungsverfahren geschaffen („Voting Choice“), Hart hält das aber offenbar für nicht weitgehend genug.
Hart will die Anleger zur maßgeblichen Stimme machen, doch das ist nicht so einfach. Wie sollen sich Millionen Kleinanleger in kurzer Zeit zu teils komplexen Fragen austauschen und gemeinsame Positionen finden? Und warum sollten die Anleger überhaupt Zeit und Gedanken für solche Fragen opfern, wenn es doch so bequem sein kann, ETF zu kaufen und sich dann um nichts mehr kümmern zu müssen?
Anleger formieren sich in Bürgerversammlungen
Hart will diese Idee auf Investoren übertragen. Aus den Millionen Blackrock-Anlegern sollen per Los 100 bis 150 Personen zufällig ausgewählt werden. Wer mehr Geld investiert hat, soll eine größere Chance haben, in die Investorenversammlung aufgenommen zu werden, dort hat dann jede und jeder eine einzige Stimme. Damit genügend Investoren mitmachen, schlägt Hart vor, die ausgewählten Personen finanziell zu kompensieren.
Schlechte Entscheidungen von Laien?
Eine Kritik an diesem Model lautet, dass die zufällig ausgewählten Personen keine Experten seien, am Ende also womöglich Entscheidungen treffen, die den Unternehmen schaden. Nobelpreisträger Hart sieht es genau andersherum. Denn im Kern gehe es um moralische Entscheidungen, und die können in seinen Augen die Investoren viel besser treffen als einzelne Manager.
Ein Beispiel: Wie viel sollte ein Wursthersteller investieren, damit die Schweine nicht stark leiden, bevor sie in der Wurst landen? Finanzexperten, so Hart, können die Kosten für entsprechende Schutzmaßnahmen präzise berechnen. Biologen wiederum können einschätzen, wie viel Schmerz und Angst die Tiere tatsächlich empfinden.
Die Investorenversammlung sollte daher möglichst qualifizierte Fachleute aus beiden Bereichen anhören. Wenn es darum geht, wie die verschiedenen Aspekte am Ende gewichtet werden, hätten die Investoren ein besseres Gespür als einzelne Fondsmanager. Schließlich sind sie es auch, die die wirtschaftlichen Folgen der Entscheidungen tragen müssen.
Sollte nicht besser der Staat Regeln bestimmen?
Ein Einwand gegen einen solchen Machtzuwachs der Kleinanleger könnte sein, dass es die originäre Aufgabe des Staates ist, die Regeln – zum Beispiel für den Tierschutz – zu bestimmen. Aktiengesellschaften können dann in diesem Rahmen mit gutem Gewissen ihre Gewinne maximieren. Harvard-Ökonom Hart misstraut diesem ordnungspolitischen Argument.
Er hält Regierungen nicht für stark und unabhängig genug, um Rahmenbedingungen zu setzen, die für die Gesellschaft und die Gesamtwohlfahrt am besten sind. Vielmehr würden Konzerne wie Exxon durch Lobbying und mit dem Einsatz von sehr viel Geld, Druck ausüben und Gesetze und Vorgaben im eigenen Interesse beeinflussen. „Wir, die Besitzer der Unternehmen, müssen etwas tun, um sie zu stoppen“, fordert Hart, „und wir haben die Macht, das zu tun, weil wir Stimmen und Kontrollrechte haben.“
Sind das alles Hirngespinste? Hart ist zuversichtlich, dass seine Idee umsetzbar ist. Er nennt Beispiele von einem dänischen Pensionsfonds der einen ähnlichen Ansatz bereits erprobt hat. Auch der Facebook-Mutterkonzern Meta habe Tausende zufällig ausgewählte Nutzer befragt, als es darum ging, soziale Regeln für die digitale Parallelwelt „Metaverse“ aufzustellen.
Im kommenden Jahr will der 76 Jahre alte Forscher seine Ideen in einem Buch präzisieren. Zumindest in Amerika dürften die Umsetzungschancen aber gering sein, solange Donald Trump das Sagen hat. Der bestimmt am liebsten selbst, was Unternehmen zu tun haben und was nicht. Rücksicht auf Tierrechte oder das Klima? Sind Trump bislang fremd.