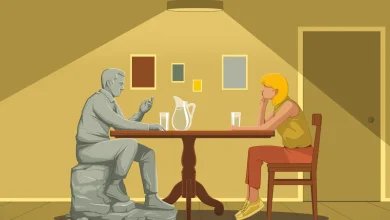Wie die SZ über das Klima berichtet | ABC-Z
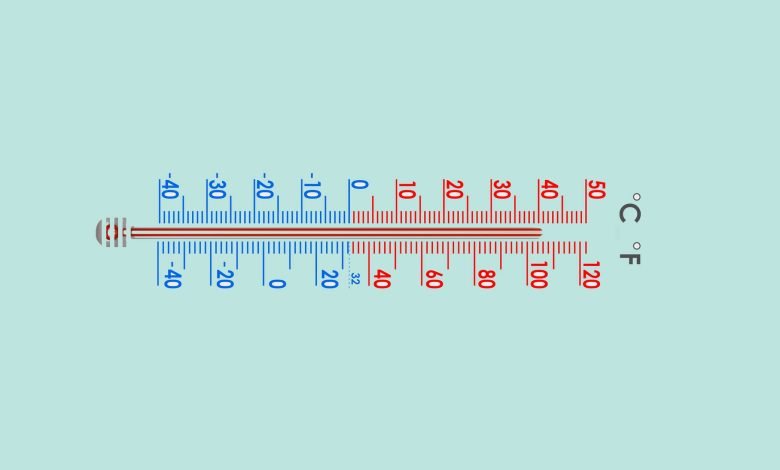
Die SZ hat das Pariser Abkommen von Anfang an begleitet, schon deutlich länger berichten Redakteurinnen und Redakteure über Ursachen und Folgen der Erderwärmung. Gelernt haben wir dabei, dass wir unseren Leserinnen und Lesern das Allermeiste, was da in unseren Postfächern landet, besser ersparen. Zum einen, weil es zeitlich gar nicht anders geht. Zum anderen aber auch, weil vieles davon für sie gar nicht mehr neu ist. Wir müssen SZ-Leserinnen und Lesern nicht mehr haarklein erklären, warum die wachsende Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre ein Problem ist oder warum es nötig ist, die Emissionen zu senken.
Die Erderwärmung ist zum Musterbeispiel für ein Querschnittsthema geworden
Ebenso müssen wir nicht mehr jede Temperaturmeldung aufschreiben, die sich von der vorherigen vielleicht in der zweiten Nachkommastelle unterscheidet. Was wir stattdessen versuchen: tiefer recherchieren, visuell anders erzählen, Menschen zu Wort kommen lassen, die von den Folgen der Erderwärmung selbst betroffen sind. Um dem verbreiteten Gefühl der Hoffnungslosigkeit entgegenzuwirken, ist es zudem wichtig, über Lösungen zu berichten und Fortschritte aufzuzeigen.
Kurzum, es ist nötig, den Klimajournalismus inhaltlich und methodisch ständig weiterzuentwickeln. Es gibt in der SZ zwar kein eigenes Klimaressort, aber eine feste Gruppe von Redakteurinnen und Redakteurinnen aus unterschiedlichen Ressorts (z.B. Wissen, Politik, Wirtschaft und Daten), die sich „Klima-Community“ nennen und regelmäßig austauschen, Themen entwickeln und Rechercheergebnisse teilen. Denn die Erderwärmung durchdringt mittlerweile ganz verschiedene Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik und ist damit zum Musterbeispiel für ein Querschnittsthema geworden.
Das bedeutet nicht, dass in der SZ nur auf eine bestimmte Art und Weise über das Klima berichtet wird. Dieser Vorwurf des Aktivismus begegnet der SZ-Redaktion gelegentlich; man kann ihm entschlossen, aber zugleich entspannt entgegentreten. Für das Klima gilt in der SZ, was auch für andere Themen gilt: Fakten und Meinungen trennen, ausgewogen statt reißerisch berichten. Gleichwohl haben sich gewisse Standards etabliert. Es gibt einen Grundkonsens in der Wissenschaft über die hauptsächlichen Ursachen und Folgen der globalen Erwärmung. Anderslautende Behauptungen von Klimaleugnern sollten daher nicht gleichrangig behandelt werden, das wäre schlicht eine Verzerrung der Tatsachen. Streiten darf und soll man aber natürlich über den Weg, wie man diesen Tatsachen politisch und gesellschaftlich begegnet.
Leserbriefe und anderes Feedback zeigen uns, dass sehr viele Leserinnen und Lesern nach wie vor stark an Informationen zum Klimaschutz und zur globalen Erwärmung interessiert sind. Solche Signale sind nicht selbstverständlich – lässt sich doch an vielen Stellen erkennen, dass der Kampf gegen die Erderwärmung politisch an Bedeutung verliert und von anderen Sorgen überlagert wird. Klimaziele werden wieder infrage gestellt, die Folgen der Erderwärmung verharmlost. Und einer Minderheit gilt es schon als voreingenommen, wenn man die Erderwärmung überhaupt thematisiert.
Diese Entwicklung ist zweifellos besorgniserregend – aber auch ein Ansporn, um dranzubleiben.