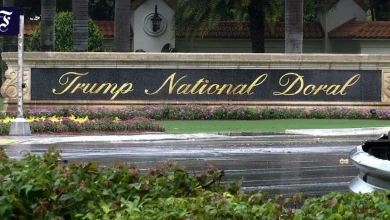Wie die Erbschaftsteuer reformiert werden könnte | ABC-Z

Erbschaftsteuer und Soziale Marktwirtschaft stehen in einem spannenden Verhältnis – man darf sogar so weit gehen, von einem Spannungsverhältnis zu sprechen. Im vorvergangenen Jahrhundert erforderte der Aufbruch in die Moderne eine zuvor unbekannte Kapitalakkumulation. Jede Steuer ist da hinderlich. Das gilt in besonderem Maße für solche auf das Vermögen, ebenso für die auf Erbschaften, die weniger oft, in unregelmäßigen, zuweilen unplanbaren Abständen erhoben wird. Ähnliches gilt für Schenkungen, auch wenn da Abzüge besser einkalkuliert werden können.
All das wirft Unternehmen zurück. Die Steuerpflichtigen müssen ihrem Betrieb Mittel entziehen, denn dort wird das große Vermögen gebildet, dort steckt das Geld. Vielleicht müssen Anteile und Beteiligungen verkauft werden. Auf jeden Fall fehlen damit Mittel für Neues. Kurzum: Kapitalismus ohne Kapital funktioniert einfach schlecht.
Der Manchester-Kapitalismus ist in Europa schon länger Geschichte. Der Staat greift in erheblichem Maße steuernd und umverteilend in das Spiel der ökonomischen Kräfte ein. Die Erbschaftsteuer (einschließlich Schenkungsteuer, um Umgehungen zu vermeiden) sorgt für einen gewissen Ausgleich. Im Extremfall mit einem Steuersatz von 100 Prozent hätte man gleiche Startchancen für alle. Doch der alte Konflikt lebt in der Sozialen Marktwirtschaft fort. Steuern auf das Betriebsvermögen erschweren Investitionen. Wer Unternehmenserben zu stark belastet, riskiert das Aus der Familienunternehmen. Das deutsche Modell mit einem starken Mittelstand, den berühmten Weltmarktführern aus der Provinz, wäre schnell am Ende.
Einspruch der Verfassungsrichter
Daher gab es immer wieder Versuche, passend zu machen, was nicht zusammen passt. Es gab viele Ansätze, Unternehmenserben zu begünstigen: Man hat Betriebsvermögen unrealistisch niedrig bewerten lassen, man hat Betriebserben in die günstigste Steuerklasse geschoben, man hat Freibeträge für Betriebsvermögen geschaffen. Das Bundesverfassungsgericht erzwang die gleiche Behandlung auf der Bewertungsebene, gestand aber dem Gesetzgeber zu, steuerliche Lenkungsziele zu verwirklichen.
Mit der bisher letzten großen Reform wurde die Steuervergünstigung an die Fortführung des Betriebs und an den Erhalt von Arbeitsplätzen geknüpft. Doch auch das ging den höchsten Richtern zu weit. Das daraufhin korrigierte Gesetz sieht nunmehr vor, dass sehr große Unternehmensvermögen von mehr als 26 Millionen Euro nicht mehr einfach so begünstigt werden dürfen. Vielmehr muss der Erbe bis zur Hälfte seines privaten Vermögens für diese Steuer einsetzen. Nur wenn er nachweist, dass er das Geld dafür nicht hat, darf er von der Steuer verschont werden. Das steckt hinter dem Wortungetüm „Verschonungsbedarfsprüfung“.
Ausnahmen streichen, Steuersätze radikal senken
Jede Ausnahme ist schön für diejenigen, die davon profitieren, und ein Ärgernis für die anderen, die nicht darunter fallen und somit härter behandelt werden. Erwartungsgemäß ist auch das aktuelle Vorgehen beklagt worden. Das Bundesverfassungsgericht will noch in diesem Jahr über den Fall entscheiden. Schwarz-Rot wird vorher nicht aktiv werden. Man scheut, vermintes Gelände zu betreten.
Aus der Wissenschaft gibt es indes ein attraktives Angebot für eine zugleich gerechte wie wirtschaftsfreundliche Reform: Ausnahmen streichen und dafür die Steuersätze radikal senken. Wie das Statistische Bundesamt Mitte dieser Woche berichtete, haben die Finanzämter im vergangenen Jahr 113,2 Milliarden Euro an Erbschaften und Schenkungen veranlagt. Kleinere sind dabei außen vor geblieben, dafür sorgen vergleichsweise großzügigen Freibeträge für enge Verwandte.
Der Eingangsteuersatz in der Erbschaft- und Schenkungsteuer bewegt sich je nach Steuerklasse zwischen sieben und 30 Prozent, der Spitzensteuersatz liegt zwischen 30 und 50 Prozent. Das Aufkommen ist dafür erstaunlich gering. Es erreichte zuletzt knapp zehn Milliarden Euro. Ein Einheitssatz von etwa zehn Prozent könnte also für stabile Einnahmen der Länder sorgen, denen das Aufkommen zusteht. Verbunden mit einer großzügigen Stundungsregelung sollte das auch für Unternehmenserben verkraftbar sein.
Gleichwohl wäre selbst diese Reform kein Selbstläufer. Die Familienunternehmen befürchten, dass es wie bei der Grunderwerbsteuer läuft. Da hatte man Ausnahmen gestrichen, um zu einem niedrigen Steuersatz zu kommen. Viele Länder haben aber seither die Belastung kräftig erhöht und so einen guten Ansatz diskreditiert. Das rächt sich jetzt, schade.