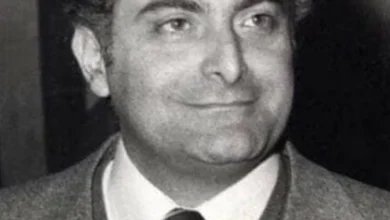Wie der Vatikan Antisemitismus den Boden entziehen könnte | ABC-Z

Die Beschreibung ist dicht und luzide. Sie bringt religiöse Erfahrung (gedacht als ein von außen bewirktes Widerfahrnis) philosophisch auf den Punkt, wo er theologisch oft unscharf bleibt. Indem der Philosoph Christoph Menke das biblische Buch Exodus (das zweite Buch Mose, der Auszug nach Ägypten) als Beispiel fürs religiöse Modell von Befreiung analysiert, ist über jüdisch-christliche Gemeinsamkeit am Ende mehr gesagt, als in kirchlichen Konsens-Papieren ausbuchstabiert wird. Nach dem Exodus-Modell von Befreiung heißt sich zu befreien, befreit zu werden, so Menke in seinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Theorie der Befreiung“ – wobei die Wirkung von außen komme, ihre Quelle und Macht sei transzendent.
Die Pointe ist antiidealistisch. Demnach wird Befreiung religiös nicht verstanden als Bewusstwerdung im idealistischen Sinne einer Subjektphilosophie („sich dessen bewusst zu werden, dass man, als Subjekt, schon frei ist; dass die Freiheit das Wesen, die (zweite) Natur des Subjekts, ist“), sondern Befreiung erscheint im Exodus als eine „radikale Gestalt antiidealistischen Denkens“. Indem das religiöse Modell die Autonomie als heteronomen Effekt beschreibe, so Menke, „denkt es – nur scheinbar paradox – materialistisch“. Denn materialistisch zu denken bedeute, „die Freiheit als eine Wirkung der Erfahrung und die Erfahrung als den Bezug auf ein uneinholbares Außen zu verstehen (das das religiöse Modell als den ,Höchsten‘ beschreibt)“.
Die antijudaistischen Ausfälle sind nicht vergessen
Es ist nicht so, als gäbe es keine Papiere, in denen kirchlicherseits die christlich-jüdischen Beziehungen herausgestellt werden. Es gibt solche Papiere, sie liegen gut abgehangen im Aktenschrank des Internets. Dort sind sie abrufbar, klar, aber dass von ihnen eine politisch-theologische Wirkung in Zeiten grassierenden Antisemitismus ausginge, wird man nicht sagen können. Angefangen von der Konzilserklärung „Nostra aetate“ (1965) reicht das offizielle Schrifttum über das Dokument der Päpstlichen Bibelkommission „Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel“ (2001) bis hin zum Papier der vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum, das die Bundestheologie von Altem und Neuem Testament unter dem Titel „Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt“ erörtert.
Die antijudaistischen Ausfälle der Kirchengeschichte sind damit nicht vergessen, aber unbestritten hat das Zweite Vatikanum neue Grundlagen für den jüdisch-christlichen Dialog gelegt. Doch wann, wenn nicht jetzt, ginge es um eine Aktualisierung dieses Schrifttums in einem zentralen vatikanischen Text, dem als theologische Solidarisierung mit dem Judentum Signalwirkung zukäme, ohne dass damit schon eine theologische, geschweige denn sakramentale Deutung des Staates Israel und seiner Politik gegeben wäre?
Hier ist die Haltung eine solche vermittelnder Distanz. Im Anschluss an den Besuch von Israels Staatspräsident Isaac Herzog neulich im Vatikan teilte das Presseamt des Heiligen Stuhls mit: „Es wurde darüber gesprochen, wie eine Zukunft für das palästinensische Volk garantiert werden kann, sowie über Frieden und Stabilität in der Region, wobei vonseiten des Heiligen Stuhls die Zwei-Staaten-Lösung als einziger Weg aus dem aktuellen Krieg erneut betont wurde.“ Im Übrigen sei es um die Freilassung der Geiseln gegangen, um einen dauerhaften Waffenstillstand und die Achtung des humanitären Völkerrechts – insoweit alles auch an Israel adressierte Themen, mit denen „die tragische Situation in Gaza“ vatikanischerseits akzentuiert wird. Aber was würde den Vatikan daran hindern, unabhängig von dem konkreten israelpolitischen Agieren des Papstes als Staatsoberhaupt seine theologische Würdigung des Judentums zu erneuern und damit dem Antisemitismus entgegenzuwirken?
Es bräuchte eine zu Herzen gehende, Israel auch religiös in die Pflicht nehmende, aber eben dem Antisemitismus den Boden entziehende Botschaft. Es bräuchte eine im Exodus-Sinne befreiende Botschaft wie seinerzeit jene von Johannes Paul II., der die Formel vom „nie gekündigten Bund“ Gottes mit dem Volk Israel prägte. Karol Wojtyla, der 1920 im polnischen Wadowice geboren wurde und dort auch zur Schule ging, gerade einmal 30 Kilometer von Auschwitz entfernt, hatte das Gespräch mit dem Judentum als einen „Dialog innerhalb unserer Kirche“ bezeichnet, er sprach von den Juden als „unseren älteren Brüdern“ – wie ließe sich der christlich-jüdische Nexus enger fassen, ohne die Eigenständigkeit der jüdischen Schriftauslegung des Alten Testaments infrage zu stellen und ohne die Denkfigur der „Erfüllung“ von christologischen Verheißungen zu strapazieren.
Es bräuchte eine prägnante theologisch-politische Botschaft der Art: Antisemitismus ist nicht nur ein widerlicher Akt gegen euch Juden, sondern auch gegen uns Christen, eure jüngeren Geschwister. Denn das Buch Exodus befreit euch wie uns. Wann spricht Leo XIV. das aus?