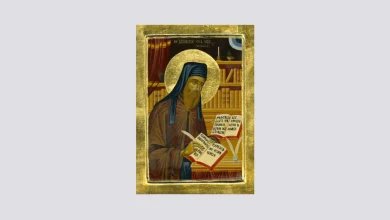Wesensveränderung nach Herzinfarkt: Hilfe durch Psychokardiologie | ABC-Z

Stand: 03.11.2025 14:08 Uhr
| vom
Nicht selten treten nach Herzinfarkt oder Herz-OP Depressionen oder Ängste auf. Die Psychokardiologie bereitet auf Eingriffe vor und hilft anschließend, die seelischen Folgen zu lindern und den Heilungsverlauf zu verbessern.
Eine Herz-Operation ist für viele Betroffene angsteinflößend – besonders, wenn am offenen Brustkorb operiert wird. Nach einer Herz-OP kann es zu psychischen Belastungen bis hin zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) mit Wesensveränderungen, Ängsten oder Depressionen kommen. Studien legen daher nahe: Wer vor einer Herz-OP psychologische Unterstützung erhält, ist hinterher schneller wieder fit, hat weniger Ängste und kann besser schlafen. Das ist wichtig, denn Unruhe und Schlafstörungen belasten wiederum das Herz.
Psychische Störungen oft Spätfolgen einer Herz-OP
Nach einer Herzklappen- oder Bypass-Operation erholen sich die meisten Menschen innerhalb weniger Monate. Doch bei einem Teil bleiben Unsicherheiten zurück: Jeder dritte Mensch entwickelt nach einer Herz-OP Ängste, jeder siebte Depressionen.
Die Zusammenhänge, was zwischen Kopf und Herz passiert, sind noch nicht ganz geklärt. Sicher ist: Herz und Gehirn sind über Nervengeflechte miteinander verbunden. Beide Organe kommunizieren also miteinander. Wenn man beispielsweise Angst hat, rast einem das Herz, das bedeutet, die Emotion löst eine Herzreaktion aus. Andererseits geraten Menschen durch Herzrasen in Panik – die Information in umgekehrter Weise funktioniert also auch.
Psychokardiologie nimmt Herz und Seele in den Blick
Die Psychokardiologie untersucht, wie Herz und Psyche aufeinander reagieren und wie dieses Zusammenspiel Betroffenen zum Beispiel vor oder nach einer schweren Herz-OP oder nach einem Herz-Infarkt nützen kann. In psychokardiologischen Zentren arbeiten Ärztinnen und Ärzte aus den Fachrichtungen Herzchirurgie, Kardiologie und Psychologie eng zusammen, um die Betroffenen umfassend zu unterstützen und vor einer psychischen Belastungsfolgen zu bewahren, beziehungsweise diese zu behandeln.
In Vorbereitung auf die Herz-OP werden psychologische Gespräche geführt und dabei die Erwartungshaltungen und Ziele der Betroffenen hinsichtlich des Eingriffs und der Zeit danach visualisiert.
Selbstwirksamkeit verbessert Heilungsverlauf nach Herz-OP
Betroffene sollen zu der inneren Überzeugung gelangen, dass sie dank ihrer eigenen Kraft die schwierige Situation gut bewältigen können. Diese sogenannte Selbstwirksamkeit kann den Heilungsverlauf verbessern und dabei helfen, eine schwere Herz-OP besser zu überstehen. Dabei geht es nicht nur um positives Denken, vielmehr sollen die Betroffenen sich ihre Zukunft bildlich vorstellen und sich Wünsche und Ziele in allen Einzelheiten ausmalen. Wichtig ist es auch, die eigenen Ängste, Sorgen und Bedenken ehrlich auszusprechen. Eine Studie zeigt, dass ein besseres Bewusstsein für die eigenen Gefühle das Herz schützen kann. Umgekehrt lässt sich die Herzfunktion günstig beeinflussen, wenn das Wahrnehmen von Emotionen therapeutisch gefördert wird. Das Fachpersonal der Psychokardiologie bereitet die Betroffenen so optimal auf die Zeit nach dem Eingriff vor.
Herzinfarkt: Wenn die Herz-OP ganz plötzlich kommt
Was aber, wenn ganz plötzlich ein Eingriff am Herzen nötig ist, etwa bei einem Herzinfarkt? Oftmals ist auch dann noch Zeit, über die Herz-OP aufzuklären. Es besteht aber die Gefahr, dass es hinterher zu psychischen Belastungen oder sogar zu einer PTBS kommt. Die plötzliche Erkrankung durchkreuzt womöglich Lebenspläne und wird als Schock oder Trauma empfunden. Bis zu 40 Prozent der Betroffenen sind nach einem Herzinfarkt psychisch so stark belastet, dass es ihre Erkrankung verschlimmert. Die Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck oder weitere kardiale Ereignisse steigt. Es ist daher wichtig, dass Betroffene Anzeichen einer PTBS wie Alpträume, Ängste und depressive Phasen wahrnehmen und erkennen, zugeben und ansprechen, damit ihnen geholfen werden kann.
Reha kann Überlebenschancen und psychische Gesundheit verbessern
Nach einem Herzinfarkt ist eine kardiologische Rehabilitation (Reha) für Betroffene wichtig, so das Ergebnis einer Meta-Studie. Es zeigte sich, dass die Teilnahme an einem speziellen Reha-Programm die Überlebenschancen der Betroffenen deutlich verbessert und dabei hilft, Komplikationen vorzubeugen. In der Reha lernen Betroffene, wie sie ihren Lebensstil ändern können, zum Beispiel durch regelmäßige Bewegung, eine herzgesunde Ernährung und den Umgang mit Risikofaktoren wie Stress, Bluthochdruck oder hohen Cholesterinwerten. Zusätzlich werden sie psychokardiologisch betreut, damit das Risiko für spätere psychische Probleme möglichst gering bleibt. Gespräche und Gruppenangebote helfen, besser mit belastenden Gefühlen umzugehen und die Krankheitsbewältigung zu erleichtern und die eigene Selbstfürsorge zu verbessern. Eine psychokardiologische oder psychologische Betreuung kann auch über die Reha hinaus erfolgen.
Nach der Herz-OP: Professionelle Hilfe durch Telefongespräche
Eine weitere Form der Nachsorge wurde in einer aktuellen Studie untersucht: Die sogenannte Blended Collaborative Care (BCC), eine telefonische Betreuung, die nicht-ärztliche Pflegekräfte mit einbezieht und sowohl die psychischen als auch die körperlichen Faktoren berücksichtigt, hat laut der Studie Erfolg bei der Nachsorge von koronaren Herzerkrankungen. Das Team unterstützt die Betroffenen telefonisch über Monate hinweg und hilft ihnen, gesunde Lebensgewohnheiten umzusetzen und besser mit Stress umzugehen. Sie fühlten sich dadurch psychisch besser, konnten Risikofaktoren besser kontrollieren und waren insgesamt zufriedener mit ihrer Behandlung. Diese Betreuung ergänzt die normale medizinische Versorgung und zeigt, dass zusätzliche telefonische Gespräche die Gesundheit und Lebensqualität deutlich verbessern können.