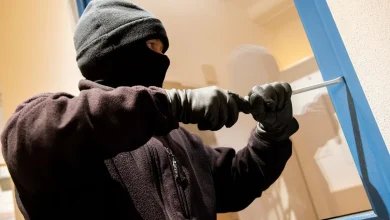Weichs: So lebt es sich in einem Bauernhofmuseum – Dachau | ABC-Z

Düster ist es in der Stube, die Fenster sind klein, die dunklen, massiven Dachbalken mit Ochsenblut eingelassen: gängiger Brandschutz, damals vor über 230 Jahren, als das Bauernhaus gezimmert worden ist. Eigentlich wäre es schon verschwunden, als Brennholz in Flammen aufgegangen, hätte sein Schicksal nicht vor gut 50 Jahren quasi in letzter Sekunde eine andere Wendung genommen.
Heute lebt Simon Kammermeier mit seiner Familie darin. 2021 ist sein Vater gestorben, der das alte Haus einst gerettet hat, da hat der heute 47-Jährige das Erbe angetreten. Dazu gehört, seine Wohnstatt im nördlichen Landkreis Dachau als privates Bauernhofmuseum zu betreiben und zum Beispiel am Tag des offenen Denkmals die interessierte Allgemeinheit einzuladen. Jüngst war es wieder so weit. Wie stets kamen viele Leute, die drei für den Tag angesetzten Führungen mussten geteilt werden. Wie gut, dass die Kammermeier-Geschwister auch diesmal zusammengeholfen haben.
Eigentlich interessierte sich Vater Alois vor allem für Taubenhäuser, hat sogar das deutsche Taubenhaus-Archiv gegründet. Doch Ende der 1970-er Jahre stieß der Münchner Frauenarzt und Heimatkundler bei einer Recherchefahrt auf etwas anderes: ein altes Bauernhaus in einem Dorf bei Au in der Hallertau im Landkreis Freising, eine Ruine schon fast, obwohl seit 1928 unter Denkmalschutz stehend: Das sogenannte „Doimerhaus“, benannt nach einem Ortsteil, war einst das Wohn- und Stallhaus eines Vollbauern, 1793 in Blockbauweise errichtet.

Der Besitzer in den 1970-er Jahren wollte das Haus trotzdem loswerden, Denkmalschutz hin oder her. Und so hat Alois Kammermeier es kurzerhand gekauft. Zum Brennholzpreis, wie er 2016 in einem Interview für die Reihe Zeitzeugen des Hauses der Bayerischen Geschichte erzählt hat. 1979 wurde es zerlegt, säuberlich nummeriert und im Hof seiner Eltern in Niederbayern eingelagert. Als Kammermeier Jahre später Haus und Grund in München für den Bau des Allacher Tunnels räumen musste, fiel es ihm wieder ein, als neues Heim, das er irgendwo aufstellen wollte.
Die Grundstückssuche führte ihn nach Ebersbach, das zur Gemeinde Weichs gehört. Ab Mitte der 1980er-Jahre wurde das Doimerhaus dort weitgehend originalgetreu wieder aufgebaut. Ein paar Jahre später kam das zweite Holzhaus aus dem 18. Jahrhundert dazu, das Wohn-und Stallgebäude des Dorfschusters aus einem Nachbardorf. So begann die Geschichte des privaten Bauernhofmuseums in Ebersbach. Weitere Exponate folgten, Backhaus- und Taubenschlag, Bienenstand, Remise und sogar ein Taubentor, dazu viele historische bäuerliche und handwerkliche Gerätschaften.


Simons Schwester Steffi Kammermeier kennt man in München als Regisseurin und Drehbuchautorin. Sie lässt für die Besuchergruppen den bäuerlichen Alltag früherer Zeiten lebendig werden. Sie führt in die gute Stube, mit der sich Bauern, die es sich leisten konnten, „einen bürgerlichen touch“ verliehen. Hier wurde zum Beispiel sonntags der Pfarrer empfangen.
Das häusliche Leben aber spielte sich in der großen Stube ab, nicht nur, weil hier der Kachelofen stand. Die wärmende Abluft tauche sogar in Klauseln bei Hofübernahmen auf, erzählt sie. So musste sich manch ein Erbe verpflichten, die Eltern zeitlebens über der Stube schlafen zu lassen. Steffi Kammermeier zeigt auf ein Loch in der Zimmerdecke, durch das die Wärme nach oben strömt.

„Von der Größe her wird es ein mittlerer Hof gewesen sein, kein Häusler“, ist Kammermeier überzeugt. Sie beschäftigt sich ebenfalls mit bäuerlicher Geschichte, hat ein Buch über das Essen früher geschrieben. In der Kuchl nebenan, „ist sicher jeden Tag für zwölf bis 15 Leute gekocht worden, dazu kamen noch die Kinder“. Am Tisch saßen Familie, Knechte und Mägde, „und wenn nicht grad gegessen wurde, haben’s alle was g’macht: genäht, geschnipselt, repariert“.
Im Gegensatz zu Bruder und Schwester, die aus der ersten Ehe von Alois Kammermeier stammen und damals schon erwachsen waren, hat Simon Kammermeier einen Teil seiner Kindheit im Doimerhaus gelebt. „Am 1. September 1990 habe ich die erste Nacht hier verbracht, das war gruselig“, erzählt er. Zwölf Jahre war er alt und musste einen harten Ortswechsel verdauen, vom modernen Bungalow in München-Allach in ein uraltes Haus auf dem Land. Ins Gymnasium ging es fortan per Bus nach Dachau, nachmittags gab es Abenteuer in der Natur.

„Ich wurde geprägt von meinem späten Vater“, betont Simon Kammermeier, das sei wichtig, weil sein Vater im Alter einen tiefgehenden Sinneswandel vollzogen habe. War er früher Werkbundanhänger mit Faible für futuristisches Bauen und Design, wurden später die Natur, das Organische und Unvollkommene immer wichtiger. Dazu war er leidenschaftlicher Sammler. Sohn Simon verfolgt einen anderen Ansatz, „puristischer“, wie er sagt. Er hat viel entrümpelt in den vergangenen Jahren.
Mit Natur und Nachhaltigkeit hat er es aber auch. Erst absolvierte er eine Lehre als Landschaftsbauer, an die Gesellenzeit hängte er dann das Studium der Landschaftsarchitektur an. Dazu ist er jetzt Ortsvorsitzender beim Bund Naturschutz.

Das Leben im Bauernhofmuseum gefällt Simon Kammermeier. Das Raumgefühl der 220 Quadratmeter Wohnfläche in dem alten Haus fasziniert ihn noch immer, er liebt den Garten und das Bankerl vor dem Haus in der Abendsonne. Längst gibt es auch Fußbodenheizung, sogar über Fernwärme aus dem kleinen Biogas-Netz eines Bauers in der Nähe. Kühl ist es im Winter trotzdem, „es ist grundsätzlich mal ein kaltes Gebäude, schlecht isoliert“, sagt er. In diesem Frühjahr hat er das Dach neu decken lassen, mit tausenden Holzschindeln aus heimischer Lärche. Und er durfte in Abstimmung mit dem Denkmalschutz sogar eine Kork-Isolierung darunter anbringen.

Sein Preis für diese wohltuende Umgebung sei die Freiheit, sagt er. „Drei Jahre in der Schweiz waren die einzige Zeit, in der ich nicht hier war.“ Seit er das Anwesen übernommen hat, ist er erst recht gebunden, der Unterhalt kostet viel Zeit und Geld. Voriges Jahr hat Kammermeier das Bauernhofmuseum Ebersbach in eine gemeinnützige GmbH überführt, damit verbunden sind einige Auflagen. In Zukunft wird es deshalb mehr volksbildnerische Veranstaltungen hier geben, er denkt etwa an Musik oder Filmvorführungen.