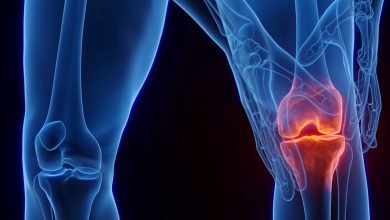Wassermelone: Gesund oder Zuckerbombe? Wir verraten es Ihnen |ABC-Z

Wassermelone
So gesund ist die Königin des Sommers
Knutschrot und Ausdruck des Protests – Wassermelonen glänzen nicht nur als Durstlöscher in der Hitze. Sind sie auch gesund oder eigentlich Zuckerbomben? Die überraschende Antwort.
Bei über 30 Grad im Schatten gibt es nur wenig Dinge, die man essen will. Rinnt der Schweiß über das Gesicht, gelüstet es mich eigentlich nur nach einer Sache: Wassermelone. Rot, saftig und süß soll sie sein – am liebsten aus dem Kühlschrank. Kaum ein Obst verbinde ich so sehr mit brütend heißen Sommertagen und Ferienbummeleien auf Märkten in Italien oder Kroatien. Meterhoch sind die unzähligen ovalen Kugeln an kleinen bunten Ständen des Südens gestapelt, manche sind so groß gewachsen, dass man sie kaum allein tragen kann.
Wenig später sieht man ein wenig aus wie Batmans Joker, mit rot verschmiertem Mund und Wangen, an denen noch Fruchtfleisch klebt. Man muss das Gesicht komplett in der halbmondförmigen Spalte versenken, um auch den letzten Rest des süßen Fleisches abzuschaben. Natürlich geht das eleganter, macht aber weniger Spaß. Manch einer entfernt die Kerne vorher mit einem Messer. Alle erreicht man nie, die übrigen werden “Pfüh”, “Pfüh”, “Pfüh” auf den Rasen gespuckt.
Die Vorliebe für Melonen scheint universell: Mit einer Weltproduktion von 100 Millionen Tonnen belegen die Wassermelonen nach Tomaten Platz zwei aller Gemüsearten. Gemüse? Richtig gelesen! Wassermelonen gehören wie Kürbis, Zucchini und Gurke eigentlich zur Familie der Kürbisgewächse.
Melonen wurden schon vor 4000 Jahren gegessen
Die meisten wachsen auf den Äckern Asiens, dabei kommen sie vermutlich aus Afrika. Schon vor 4000 Jahren soll man sie in Ägypten kultiviert haben, zumindest lassen darauf Samen in alten Gräbern schließen. Wahrscheinlich hat man sie damals schon für ihren hohen Wassergehalt geschätzt, der vor allem in Trockenzeiten von Vorteil gewesen dürfte. Tausende Generationen selektiver Zucht brauchte es danach, um aus der bitter schmeckenden Wildvariante mit hartem Fruchtfleisch die süße Erfrischung zu machen, die uns durch den Sommer begleitet. Hunderte Sorten unterschiedlicher Wassermelonen gibt es heute. International gehandelt werden jedoch nur wenige. Besonders häufig findet man in heimischen Supermärkten “Sugar Baby”(tiefrotes, saftiges Fruchtfleisch und dunkelgrüne Schale) und “Crimson Sweet” (außen grün gestreift, innen satt hellrot).
Sogar ein Politikum ist die Wassermelone: Mit ihren Farben (grün, rot, weiß und schwarz) ist sie 1967 zum Symbol der Solidarität mit den Palästinensern und zum Ausdruck des Protests geworden. Israel hatte damals nach dem Sechstagekrieg die Verwendung der palästinensischen Flagge in den besetzten Gebieten verboten. Seitdem sieht man sie immer wieder als Plakat auf Demonstrationen, als Aufkleber auf Autos oder als Emoji in sozialen Medien. Doch nicht nur die Farben verbinden die Menschen hier mit der Melone. Die Früchte werden im Westjordanland und im Gazastreifen angebaut und sind ein nicht wegzudenkendes Grundnahrungsmittel in der palästinensischen Küche.
Ihrem Namen macht sie alle Ehre, denn sie besteht tatsächlich zu mehr als 90 Prozent aus Wasser, was sie zu einem idealen Durstlöscher macht. Doch obwohl sie herrlich süß schmeckt, enthält sie nur etwa 6 Gramm Zucker pro 100 Gramm Fruchtfleisch. Mit 37 Kalorien auf die gleiche Menge muss man sich auch keine Sorgen machen, wenn man mehrmals zugreift.
Die kleinen, dunklen Samen kann man entgegen allen Vorurteilen ebenfalls essen. Sie enthalten unter anderem Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen. Auch im Fruchtfleisch steckt viel Gutes: Vitamin A etwa genauso wie Vitamin B5, B6 und Vitamin C. Dazu kommen eine ganze Reihe unterschiedlicher Mineralstoffe.
Wassermelone für die Gefäße
Gern hingewiesen wird auf ihren Citrullin-Gehalt. Die Aminosäure wird im Körper in Arginin umgewandelt und beeinflusst die Weite der Blutgefäße. So soll sie auf natürliche Weise helfen können, den Blutdruck zu senken. Am höchsten ist die Konzentration allerdings in der Schale. Lycopin ist noch so ein Stoff, dem eine positive Wirkung auf das Herzkreislaufsystem nachgesagt wird. Der Farbstoff verleiht dem Fruchtfleisch der meisten Wassermelonen seine rote Farbe. Doch er kann noch mehr: Als sekundärer Pflanzenstoff wirkt er entzündungshemmend und kann freie Radikale unschädlich machen, die zu Schäden an den Zellen führen können. So werden Lycopin zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben.
Gute Studien, die einen besonders positiven Effekt vom Wassermelonen-Genuss auf die Gesundheit zeigen, gibt es allerdings nicht. Auch Medikamente werden sie nicht ersetzen können. Als Teil einer ausgewogenen Ernährung können sie trotzdem gut für die Gefäßgesundheit sein und in der Kombination mit anderen Lebensmitteln einige Schäden verhindern.
Für die meisten dagegen geht es ohnehin um den Geschmack – und der kann deutlich schwanken. Die echten Wassermelonen-Kenner lassen sich im Supermarkt schnell ausmachen. Kaum haben sie die Melone im Arm, drehen sie diese blitzschnell herum, um einen Blick auf einen kleinen, hellen Fleck zu erhaschen. Er markiert die Stelle, an der die Melone während ihres Wachstums Kontakt mit dem Boden hatte und ist ein wichtiges Indiz: Je gelber der Fleck ist, desto reifer die Frucht. Dann folgt das Klopfen. Ganz nah kommt das Ohr an die Melone heran. Während die Finger vorsichtig auf die Schale trommeln, lauschen die Käufer, als erwarteten sie eine Antwort. Erst nach einem zufriedenen Nicken landet die Frucht im Einkaufswagen. Was passiert da? Ein dumpfer, voller Klang beim Klopftest deutet auf eine reife, saftige Frucht hin. Schallt es hell aus der Melone heraus, ist sie noch unreif.