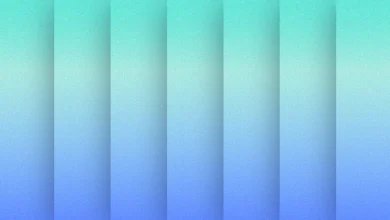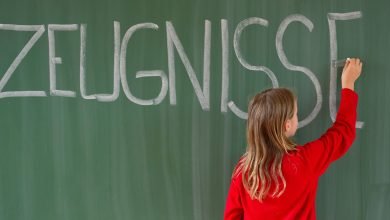Was Sie zu Trumps neuen Zolldrohungen wissen müssen | ABC-Z

Der aktuelle Stand: Der amerikanische Präsident Donald Trump hat die von ihm im April angekündigten drastischen Zollerhöhungen für alle Staaten abermals verschoben – diesmal auf den 1. August. Für Brasilien hat er nun einen Zollsatz von 50 Prozent angekündet, weil das Land eine „Hexenjagd“ gegen den frühreren Präsidenten Jair Bolsonaro betreibe, der nach der Wahl 2022 einen Putschversuch geplant haben soll. Weitere 20 Ländern hat Trump per Brief mitgeteilt, dass die ursprünglich angekündigten Importzölle leicht gesenkt würden, darunter für Japan, Südkorea, die Philippinen, Moldau, Serbien und Indonesien. Zudem droht Trump mit höheren Zöllen auf Kupfer, in Höhe von 50 Prozent.
Für die 20 Staaten sind demnach Zollsätze auf Einfuhren von mindestens 25 Prozent und bis zu 40 Prozent vorgesehen – ursprünglich waren bis zu 49 Prozent angedroht. Diese neuen Zollsätze sollen vom 1. August an gelten – außer diese Staaten schließen bis dahin Handelsabkommen ab.
Sein Motiv: Im April hatte Trump angekündigt, er erwarte wegen seiner hohen Zollforderungen „90 Handelsverträge in 90 Tagen”. Bislang konnte er sich aber nur mit drei Ländern – Vietnam, Großbritannien und China – grundsätzlich einigen. Kein Wunder, denn normalerweise dauert es Jahre, Handelsverträge auszuhandeln, da dabei über unzählige, höchst unterschiedliche Produktgruppen und Regulierungsanpassungen gesprochen werden muss.
Zugleich scheint der US-Präsident sich eine Verschiebung nun leisten zu können: Den republikanischen Abgeordneten im Kongress, die sich um die steigende Staatsverschuldung sorgten, hatte er vor der Abstimmung zur umstrittenen Steuerreform namens „One Big Beautiful Bill“ in Aussicht gestellt, die erwarteten massiven Steuerverluste durch hohe Zolleinnahmen auszugleichen. Da eine Mehrheit der Kongressabgeordneten das Gesetz am 3. Juli abgesegnet hat, dürfte Trump sich nicht länger gezwungen fühlen, sein Versprechen umgehend einzulösen.
Folgen für Deutschland: Um knapp 14 Prozent sind im Mai 2025 die deutschen Exporte in die USA gesunken im Vergleich zum Mai 2024, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Denn wurden 2024 viele deutsche Waren gar nicht oder nur mit wenigen Prozent bei der Einfuhr in die Vereinigten Staaten verzollt, werden seit Trump inzwischen grundsätzlich 10 Prozent aufgeschlagen. Für Waren aus Eisen, Stahl und Aluminium – etwa Maschinenteile – werden 50 Prozent Zoll verlangt.
Autos und Autoteile aus Deutschland werden mit 25 Prozent verzollt. Davon sind deutsche Hersteller unterschiedlich stark betroffen, da einige von ihnen Werke in den USA oder auch im Nachbarland Mexiko haben, für das das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA weiterhin gilt. Der Importzoll wird bei in Nordamerika montierten Fahrzeugen nur auf jene Teile im Auto angewendet, die aus Deutschland kommen.
Für die Bundesrepublik sind die USA der wichtigste Außenhandelspartner, noch vor Frankreich. Jährlich werden Waren im Wert von 161 Milliarden Euro an Amerikaner verkauft. Die wichtigsten Exportgüter sind Maschinen, Autos und Autoteile sowie Medikamente. Trump hat für Deutschland keine eigenen Zollsätze definiert, es gelten jene für die Europäische Union, da Außenhandel eine EU-Angelegenheit ist. Für die gesamte EU hatte Trump im April einen Mindestzoll von 20 Prozent angedroht. Die EU-Kommission hofft, sich mit dem Weißen Haus auf zehn Prozent einigen zu können.
Die finanziellen Folgen: Am 4. Juli hat Trump das Reformpaket „One Big Beautiful Bill“ unterzeichnet, das Zolleinnahmen von ungefähr 180 bis 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr einkalkuliert hatte. Wenn Trump die Zollerhöhungen weiter verschiebt und zwischendurch Handelsverträge vereinbart, werden diese Einnahmen jedoch kaum erzielt werden und die Staatsschulden der USA noch schneller steigen als ohnehin erwartet: Das Reformpaket wird die US-Schulden bis 2034 von aktuell 36 Billionen Dollar um mindestens 3,4 Billionen Dollar erhöhen, prognostiziert das überparteiliche Congressional Budget Office.
Der Hintergrund: Höhere Zölle hält Trump für das am besten geeignete Instrument, um die ins Ausland abgewanderte Industrie zurück in die USA zu holen. Den Handelspartnern wirft er vor, die Vereinigten Staaten auszunutzen, als Beleg dafür verweist er auf die hohen Handelsdefizite, also dass die USA aus nahezu allen Staaten erheblich mehr importieren als exportieren. Die meisten Ökonomen betrachten diese Defizite eher als Ausweis der hohen Wirtschafts- und Konsumkraft und sehen eher Zölle als Gefahr für die US-Inflation und die Konjunktur.
Schon im Februar, wenige Tage nach seinem Amtsantritt als Präsident, hatte Trump erste Zollerhöhungen angekündigt, damals zunächst nur für chinesische Waren. Im März folgte die Ankündigung höherer Importabgaben für Waren aus Mexiko und Kanada in Höhe von 25 Prozent. Am 2. April schließlich präsentierte der US-Präsident eine ganze Liste an neuen Sätzen für nahezu alle Staaten weltweit: einen Basissatz von zehn Prozent plus Aufschlag je nach Höhe des Handelsdefizits. Am 9. April sollten sie in Kraft treten. Nach Turbulenzen an den Finanzmärkten jedoch setzte Trump die Zölle bis zum 9. Juli aus.
Die Widersprüche: Wenn Trump die Industrieproduktion tatsächlich ins Land zurückholen will, müsste er auf hohen Zollsätzen bestehen und diese langfristig beibehalten, damit sich für Unternehmen die Verlagerung und der Bau milliardenteurer Fabriken rechnet und realisiert werden kann. Jedoch hat Trump immer wieder angekündigt, er ließe über Zölle mit sich verhandeln. Wenn sie infolge der Verhandlungen niedrig bleiben, rechnet sich eine Umverlagerung der Produktion aber nicht.
Trump behauptet auch, höhere Zölle würden die US-Konsumenten nicht belasten, sondern wären von den Ländern zu zahlen. Tatsächlich würden sie die amerikanische Inflation anheizen. Denn die Einfuhrzölle müssten von den amerikanischen Importeuren, nicht von den Ländern, bezahlt werden. Diese Importeure würden dann die höheren Kosten auf die Verbraucherpreise aufschlagen.
Die tatsächlichen Deals: Bisher hat sich die US-Regierung grundsätzlich nur mit Vietnam und Großbritannien auf Bedingungen für ein Zollabkommen einigen können. Mit China gibt es einen vorläufigen Kompromiss. Vietnam ist – seit den Hochzöllen gegen China in Trumps erster Amtszeit – einer der wichtigsten Ausweichstandorte für chinesische Produzenten. Amerikanische Importeure vietnamesischer Waren sollen nun einen Zoll von 20 Prozent zahlen. Für Produkte, die in Vietnam nur umgeladen werden, werden laut Weißem Haus 40 Prozent fällig.
Britische Importwaren sollen mit zehn Prozent belegt werden. Dieser Satz gilt auch für Autos, sofern maximal 100.000 pro Jahr in die Vereinigten Staaten importiert werden, alle weiteren würden mit 27,5 Prozent belastet. 2024 hatten britische Hersteller 102.000 Fahrzeuge nach Amerika verschifft. Zollsätze für andere Produkte, etwa Stahl, Aluminium und Pharmazeutika, werden allerdings noch verhandelt.
China und die USA hatten sich seit Trumps Amtsantritt geradezu einen Wettstreit um die höchsten Importzölle geliefert, zeitweise wurde mit 125 Prozent gedroht. China ist der größte Handelspartner der USA und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat aber auch das größte Handelsdefizit. Ende Juni sollen Washington und Peking sich laut US-Regierung darauf verständigt haben, dass chinesische Einfuhren in die USA mit 55 Prozent verzollt werden und umgekehrt China zehn Prozent auf amerikanische Waren berechnet. Zudem soll Peking den Zugang zu Seltenen Erden erleichtern.
Die Märkte: Investoren und Anleger mögen keine Zölle, die den Welthandel bremsen und Waren verteuern, das haben die Marktreaktionen der vergangenen Wochen deutlich gezeigt. Vor allem nach Trumps „Liberation Day“ im April waren die Börsenkurse weltweit eingebrochen, ebenso der Wert der sonst stabilen US-Staatsanleihen – ein Alarmsignal, das damals auch Trump nicht entgangen war, woraufhin er seine Androhungen vertagte. Seitdem haben sich die Aktienmärkte zwar erholt, doch der Dollarkurs hat seit Jahresbeginn rund 15 Prozent auf den Euro eingebüßt.
Die Rechtsfrage: Darf Trump das überhaupt? Darüber verhandeln in den USA derzeit Gerichte. Ein US-Bundesgericht, der US Court of International Trade, hatte viele der Zollerhöhungen für illegal erklärt, da der US-Präsident sie zu Unrecht mit seinen Handlungsrechten wegen eines „Notstands“ begründe. Die Zölle müssten vielmehr vom Kongress festgesetzt werden. Da die US-Regierung gegen dieses Urteil Berufung eingelegt hat, wird es nicht vollzogen, die Zollsätze gelten damit weiterhin. Nun wird der Fall erst vor einem Berufungsgericht und dann endgültig vor dem Verfassungsgericht, dem Supreme Court, entschieden.
Theoretisch könnten andere Länder auch vor der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) gegen die USA klagen. Doch das dortige Schiedsgericht ist seit Jahren weitgehend gelähmt, da die USA seit Jahren die Nachbesetzung frei werdender Richterstellen blockieren.