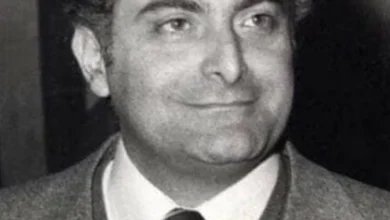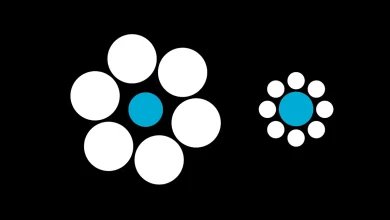Warum Monty Pythons „Die Ritter der Kokosnuss“ trotz Minibudget zum Klassiker wurde | ABC-Z

Wenn zwei Regienovizen einen Film mit schmalstem Budget drehen und eine Komikertruppe dafür jeweils mehrere Rollen – zum Teil sogar in einer Szene – spielen muss, dann darf man getrost davon ausgehen, von diesem Projekt nie wieder etwas zu hören. Es sei denn, bei den Regieneulingen handelt es sich um Terry Gilliam und Terry Jones und bei den Darstellern um ihre Kollegen von der britischen Satiregruppe Monty Python. Vor fünfzig Jahren drehten diese Leute gemeinsam den Film „Die Ritter der Kokosnuß“, der seitdem so viele Zuschauer begeisterte, dass die britische Post dem Werk im Jubiläumsjahr sogar eine Briefmarke widmete.
„Wir brauchten ein Projekt, bei dem wir alle sechs mitmachen konnten“, erinnerte sich Monty-Python-Mitglied Michael Palin unlängst in einem BBC-Interview. Im Jahr 1974 war die Sketch-Sendung „Monty Python’s Flying Circus“ abgesetzt worden, die Komiker versuchten also, ihren Humor in Filmform auszuprobieren. „Die Tafelrunde schien uns perfekt geeignet, denn so konnte jeder einen Ritter spielen“, so Palin. „Zudem sagte die Legende vom Heiligen Gral allen etwas, ohne dass irgendjemand etwas Genaueres darüber wusste. Das ließ uns viel Freiraum für die Geschichten, die wir um die Gralssuche stricken konnten.“
„Besuchen Sie Schweden und seine majestätischen Felltiere“
Der kreative Freiraum begann schon beim Vorspann, der auch im englischen Original mit schwedischen Untertiteln beginnt, die schnell zu einer Tourismuswerbung für Skandinavien und seine Elche mutiert („Besuchen Sie Schweden und seine majestätischen Felltiere“). Auch nachdem „die Untertitelverantwortlichen gefeuert wurden“, tapsen die Tiere durch die Besetzungsliste, in der ein „Elch-Choreograph“ und diverse „Elch-Trainer“ genannt werden, die den Elchen sowohl Latein, Geographie als auch Zementmischen beigebracht haben sollen. Natürlich wird man in den folgenden neunzig Minuten nicht einen Elch erspähen. Die Filmemacher hatten ja nicht einmal für die Pferde Geld.
Rund 300.000 Pfund standen für die Dreharbeiten zur Verfügung, bereitgestellt von den befreundeten Rockbands Pink Floyd und Led Zeppelin sowie von Elton John. Für die Musiker war das ein guter Weg, die hohe britische Einkommensteuer geschickt zu umgehen. Für die Filmemacher bedeutete das geringe Budget, dass sie aus der Not eine Tugend machen und mit wenig Personal in Schottland drehen mussten.
Mancher übernahm bis zu sechs Charaktere
„Wir waren große Fans von Bruegels Gemälden und Pasolinis Filmen, wir wollten so viel Realität wie möglich in unserem Film haben“, erzählte Terry Gilliam später. Genau zwei Schlösser dienten als Drehorte; die wurden für Artus’ Reise durch die Lande immer wieder aus unterschiedlichsten Kameraperspektiven aufgenommen, um Varianz vorzutäuschen. So hielt man es auch mit der Besetzung. Das Team teilte sich in sämtliche Rollen. Dass man die Ritter zum Teil getrennt in ihre Abenteuer schicken konnte, half gewiss, denn so ließ sich das Sketch-Format der Fernsehserie für den Film adaptieren. Und man hielt die Personalkosten gering, denn mancher übernahm bis zu sechs verschiedene Charaktere. So spielte John Cleese etwa sowohl den übermütigen Sir Lancelot, der, einmal in Fahrt gekommen, auch eine unschuldige Hochzeitsgesellschaft niedermetzelt, als auch den gehörnten Zauberer Tim mit starkem schottischem Akzent, und er sprang ein als schwarzer Ritter, der im Kampf selbst dann nicht aufgibt, wenn er keine Gliedmaßen mehr hat („Sagen wir Unentschieden, ich hab’ immer noch meine Zähne“), gab zudem einen französischen Adligen, der Artus von den Burgzinnen aus verspottet, und einen Burgwächter, der mit dem König der Briten über die Fluggeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe debattiert.
Und da das Absurde ohnehin eine Grundlage des pythonesken Humors war, beschloss man, den Pferdemangel frontal anzugehen. Ließ also die Knappen im Film mit zwei leeren Kokosnusshälften aufeinanderschlagen und so das Geräusch von Hufgetrappel nachahmen. John Cleese, Graham Chapman und Michael Palin bewegten sich dazu mit reitenden Schritten durch die Felder. Ich glaube, als ich diesen Film zum ersten Mal sah, Mitte der Neunzigerjahre, auf einer VHS-Kassette, die ein Freund irgendwoher besorgt hatte, nachdem uns „Monty Python’s Fliegender Zirkus“ zum ersten Mal nachts im Programm eines dritten öffentlich-rechtlichen Senders begegnet war, musste ich schon beim ersten kokosnussklappernden Knappen sehr lachen.
Beim Wiedersehen entdeckt man den Humor an anderen Stellen, etwa wenn Artus sich einer Gruppe Bauern als ihr König vorstellt und diese ihm statt Respektsbekundungen die Vorzüge ihrer anarchistischen Kommune entgegenhalten. Oder bei den vielen Miniaturen völlig sinnloser Tätigkeiten, die in den großen Tableaus im Hintergrund ausgeführt werden – ein Bauer schlägt mit einem Ast auf einen Fluss ein, jemand wirft sein Haustier gegen eine Zeltwand. Kann man die lange Zivilisationspause und den Aberglauben des Mittelalters besser illustrieren?