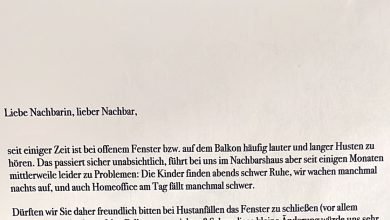Warum ein Jude in den USA nun Deutscher ist | ABC-Z

Es gibt dieses Foto von Georg Nathan. Schwarz-weiß, handschriftlich ist unten notiert: „Emmericher an der Westfront, Ostern 1916“, Erster Weltkrieg. Es sind Soldaten der deutschen Armee aus der Stadt am Rhein. Alle in Uniform, zugeknöpft bis zum Kragen. Fast alle tragen Schnauzbart, manche Schirmmütze, andere Krätzchen, die Militärkappe im preußischen Kaiserreich.
In der mittleren Reihe, der zweite von links, da sitzt Georg Nathan, die Arme verschränkt, der Blick ernst, die Augen fokussiert auf die Kamera. Nathan, der Jude aus Emmerich, Sohn eines Metzgermeisters, dient den Kaisertruppen im Kampf gegen die Franzosen.
Die Deutschen werden Nathan später ehren, ihm ein Eisernes Kreuz für die Verdienste an der Front anheften. Die Deutschen werden ihn 1941 ins Ghetto nach Riga deportieren und umbringen.
Manchmal, in den zwei Stunden, in denen sein Enkel vom Großvater erzählt, stockt die Stimme. Er bricht ab, schluckt, ringt mit den Tränen. Er heißt George, so wie der „Opa Schorsch“, wie Nathan im breiten Amerikanisch sagt. „Gib‘ mir eine Sekunde.“ Der Enkel trägt das emotionale Erbe des Großvaters in sich. Man spürt das in fast jedem Satz.
Als Jude in den USA: Eine Exit-Strategie für den Notfall
George Nathan, Mitte 70 und pensionierter Ingenieur, lebt heute in den USA, im Norden der Metropole Atlanta. Nathan ist Amerikaner, er liebt sein Land. Doch in ihm wächst auch Sorge. Er blickt mit einem unguten Gefühl auf das politische Klima in den USA. Und auf die Situation der Juden in Amerika, das einst vielen von ihnen das Leben rettete. Der Enkel denkt in dieser Zeit noch öfter als sonst an die Geschichte seines Opas.
Wie er sich fühle unter Donald Trump. „Ich fühle mich nicht sicher.“ Und wenn ihn das Schicksal seiner Großeltern etwas gelehrt habe, dann sei das eines: Es gibt keinen sicheren Ort für Juden. Nicht in Israel, nicht in den USA. Zeiten ändern sich immer. Eisernes Kreuz, Deportation und Tod – der Großvater hat es erlebt. „Du brauchst Optionen“, sagt der Enkel. Eine Exit-Strategie für den Notfall.
George Nathan mit seiner Frau Barbara. Sein Großvater entschied sich gegen die Flucht aus Deutschland. „Das kostete ihn das Leben.“
© Sara Baurley | Sara Baurley
George Nathan ist deshalb nun nicht mehr nur US-Bürger, sondern auch Deutscher. 2019, in der ersten Amtszeit von Donald Trump, beantragt er die Staatsbürgerschaft im Konsulat der Bundesrepublik in seiner Heimatstadt Atlanta. Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes macht es möglich. Wer zwischen 1933 und 1945 verfolgt und ausgebürgert wurde, bekommt seinen Pass zurück. Das gilt auch für Nachfahren von Getöteten und Vertriebenen im Holocaust.
Nathans Weg zum Deutschen ist eine Geschichte über das Amerika von heute. Ein Land, in dem die demokratischen Institutionen unter Beschuss stehen und unabhängige Justiz politisiert wird. In dem Radikale an Macht gewinnen, auch im Weißen Haus, und Minderheiten, gerade Muslime und Geflüchtete, zu Feindbildern wachsen. Eine aufgehetzte Stimmung, die auch Menschen wie Nathan spüren.

Deutschen gedient, von den Deutschen getötet: Das Foto zeigt Georg Nathan (mittlere Reihe, zweiter von links) in Uniform des Deutschen Reichs, im Sommer 1916, Westfront.
© privat | Privat
Damit aber ist in Nathans Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit nur ein Kapitel angesprochen. In den Gedanken des Enkels hat der Stammbaum der Familie tiefe Wurzeln geschlagen. George Nathan sagte, er fühle sich mit dem Zertifikat zur Einbürgerung der Geschichte seiner Großeltern näher. Das Land der Täter – Nathans innere Kompassnadel weist ihn immer wieder dorthin.
Georg Nathan wurde 1880 in Emmerich geboren. Die Nathans sind eine Familie mit einer langen jüdischen Tradition in der Stadt am Rhein, Spuren gehen zurück ins 18. Jahrhundert. Juden in Emmerich arbeiteten in der Textilproduktion, im Ledergeschäft, als Metzger. „Opa Schorsch“ verdiente gut als Viehhändler, die Familie lebte in einem Haus direkt am Flussufer, heute ist dort die Rheinpromenade.

Als die Nazis die Juden in Deutschland immer stärker verfolgten, so erzählt es der Enkel heute, entschieden manche Nathans in Emmerich, das Land zu verlassen.
Juden bekamen kein Visum, stattdessen wurde ein rotes „J“ in ihren Reisepass gestempelt
Opa Schorsch aber blieb. Die Geschäfte liefen gut, er hatte ein Haus am Fluss, Landbesitz am Rhein, eine Haushälterin, eine Köchin. Er arbeitete in Deutschland, er hatte dem Land im Krieg gedient, Freunde und Familie hier. Fliehen? Alles zurücklassen? Georg Nathan entschied sich dagegen. „Das kostete ihn das Leben“, sagt sein Enkel heute.
In der Reichspogromnacht im November 1938 brannten in Deutschland Synagogen, Nazis jagten Juden, erteilten Berufsverbote. Die Nationalsozialisten nahmen Georg Nathan fest, randalierten in seinem Haus. Als er zehn Tage später aus der Haft kam, war es für eine Ausreise zu spät. Juden bekamen kein Visum mehr, stattdessen wurde ein rotes „J“ in ihren Reisepass gestempelt.

Das Eiserne Kreuz des Großvaters. Es rettet ihn 1941 nicht vor der Deportation.
© Sara Baurley | Sara Baurley
Im Dezember 1941 erreichte der Befehl der Gestapo Georg Nathan per Post, man werde zum „Arbeitseinsatz im Osten evakuiert“. Die Sammelstelle lag in einem Schlachthof in Düsseldorf, nur zwei Gepäckstücke waren erlaubt. Das Vieh war gerade verschwunden, der Geruch noch da. „Der Weg zum Schlachthof war ein Leidensweg, ein Spießrutenlaufen. Die Bevölkerung gaffte uns an, als habe sie bisher noch keine Menschen gesehen“, schrieb die Überlebende Liesel Ginsburg-Frenkel nach dem Krieg in ihren Erinnerungen.
Die Nazis zwangen an diesem Tag Juden aus Mönchengladbach, Krefeld, Moers und Emmerich in das Gemäuer, dann in die Züge nach Riga, ins Ghetto. „Die Kinder lagen im Schnee und weinten“, erzählte eine Jüdin später. Es waren Georg Nathans letzte Stunden in Deutschland.
Mehr als 80 Jahre später hat sich sein Enkel in Atlanta, USA, für dieses Videotelefonat mit Material gerüstet, mit Fotos, mit einem großen Blatt, auf dem mit Stift der Stammbaum der Familie aufgemalt ist, jeder Name in einem Kästchen, mit Linien verbunden. Von Isaak Nathan, der 1822 in Emmerich geboren wurde, bis zu Ted, Gil und Ben – George Nathans Söhne. Wie George haben zwei von ihnen bereits deutsche Pässe.
Die Juden sind zurück in Deutschland, Nathans Familie ist zurück
Vater George Nathan sagt: „Meine Kinder sollen wissen, wo ihre Familie herkam, was sie durchmachte.“ Und der Enkel der Holocaust-Verfolgten sagt noch etwas: „Hitler hat nicht gewonnen.“ Die Juden sind zurück in Deutschland, seine Familie ist zurück. Wenn auch erstmal nur per Reisepass.
Und die Nathans sind nicht allein. Die Zahl der Anträge auf Einbürgerungen von Nachfahren der Holocaust-Verfolgten lag 2023 laut Bundesverwaltungsamt in Köln bei 1646. 2024 waren es 3843 Anträge. In den ersten sechs Monaten 2025 beantragten schon 3232 US-Bürger die deutsche Staatsbürgerschaft, weil ihre Vorfahren von den Nazis getötet oder verfolgt worden waren.

Fotos der Familie, ein gezeichneter Stammbaum, alte Urkunden. George Nathan pflegt die Geschichte seiner Großeltern wie ein Archivar.
© Sara Baurley | Sara Baurley
Die Zahl der Anträge steigt, ziemlich stark. Eine Auswertung des Bundesamtes auf Nachfrage unserer Redaktion zeigt, dass sich 2017 und 2018 deutlich mehr amerikanische Juden einbürgern lassen wollten als in den beiden Jahren zuvor. 2017 wurde Trump zum ersten Mal Präsident.
Danach sinken die Antragszahlen wieder. Jetzt, 2024 und 2025, liegen sie auf Rekordniveau. Das Bundesamt teilt auf Nachfrage mit, dass es keine Motive der Menschen erfasst. Auch das Außenministerium weiß nichts zu berichten. Es gibt keine Auswertungen darüber, warum Juden in den USA die Staatsbürgerschaft beantragen. Es bleiben Anekdoten, Geschichten, Thesen.
Der Anstieg kann zum einen auf ein leichteres Verfahren zurückgehen. 2021 erweiterte die damalige Bundesregierung das Staatsbürgerrecht für Angehörige von NS-Verfolgten, erleichterte die Anträge. Manchmal können die Gründe auch wirtschaftlich sein, etwa wenn das Leben in Tel Aviv immer teurer wird – und die Mieten in Berlin für junge Israelis noch immer günstig erscheinen.

George Nathan hält die Staatsbürgerurkunde in der Hand. Seine Frau Barbara reiste mit ihm nach Deutschland, in die Heimat seiner Großeltern.
© Sara Baurley | Sara Baurley
Nach dem Krieg dauerte es Jahrzehnte, bis Jüdinnen und Juden überhaupt wieder in größerer Zahl einen Fuß nach Deutschland setzten. Auch die Bundesrepublik taute aus dem Trauma auf, öffnete sich. Mittlerweile gibt es wieder buntes jüdisches Leben in Deutschland. Das kann ein Grund sein, warum die Einbürgerungen steigen – der Migrationsmagnet wird stärker. Deutschland ist ein Pull-Faktor, auch wieder für Juden.
Da ist aber noch etwas, ein Riss im Vertrauen zur eigenen Heimat. Oder besser: zur aktuellen Regierung. Auch davon erzählt George Nathan. Und es sind weitere Jüdinnen und Juden, die so denken. Wer Umfragen analysiert, sieht, dass Juden in den USA mehrheitlich liberal eingestellt sind, die Demokraten wählen. Nicht einmal ein Drittel der jüdischen Gemeinde stimmte 2020 für Trump. Politisch – und nicht aufgrund ihres Glaubens – blicken viele mit Sorge auf die autoritären Züge des Präsidenten. Das ist ein Push-Faktor.
Ein anderer ist der wachsende Antisemitismus. Irene Möllenbeck ist Vorsitzende der Bürgeraktion Pro Kultur in Emmerich. Sie pflegen die jüdische Geschichte in der Stadt. Möllenbeck vermittelte den Kontakt zu Nathan. Und sie erzählt: „Wir erleben jetzt, dass sich mehrere jüdische Familien in den USA nicht mehr sicher fühlen.“
Auch nach dem Terrorangriff der Hamas beantragten Israelis die deutsche Staatsbürgerschaft
Möllenbeck hilft den Familien in den USA, Dokumente für die Einbürgerung zu sammeln. Heiratsurkunden, Geburtsurkunden. „Es ist eine Vorsichtsmaßnahme für viele von ihnen, wenn sich ihre Lage in den USA weiter verschlechtert“, sagt sie. Ein Plan B.

Unsere Redaktion hat sich umgehört. Der Zentralrat der Juden möchte sich auf Nachfrage nicht äußern. Aber der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, beobachtete, wie nach 2020 die Anträge auf Einbürgerung von Jüdinnen und Juden aus England stiegen. Damals trat das Königreich aus der EU aus, Brexit.
Auch nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 beantragten Menschen aus Israel die deutsche Staatsbürgerschaft, berichtet Klein. Krisen und Kriege treiben Menschen zur Flucht. Einst wollte George Nathans Großmutter nach Israel fliehen. Damals war es zu spät. Nun kehren Juden zurück in das Land der Täter – auch um hier Schutz zu finden. Felix Klein sagt, dass das ein „unglaublicher Vertrauensbeweis für Deutschland“ sei.

Im Mai 2025 erschüttert die tödliche Attacke auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington die USA.
© ZUMA Press Wire/dpa | Mehmet Eser
Und Klein stellt ebenfalls fest, dass die Anträge aus den USA steigen. Er bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass Familien mit der Staatsbürgerschaft ihre eigene Geschichte aufarbeiten wollen. Und Klein sagt auch, dass Jüdinnen und Juden besorgt über das „politische Klima in den USA“ seien, „in dem der Rechtsextremismus wie auch hier in Deutschland auf dem Vormarsch ist“. Antisemitische Verschwörungsmythen würden „blühen“, so der Beauftragte, „leider auch in den USA sehr stark“.
Es lohnt ein genauer Blick. Donald Trump fällt auf mit harter Politik gegenüber Migranten, vor allem Muslimen. 2017 erließ er sogar eine Einreisesperre, den „Muslim ban“. Heute weist er massenhaft Migranten aus dem Süden aus. Staatliche Gewalt wächst unter Trump zu einem politischen Hebel.
Juden trifft das bisher nicht. Studien zeigen aber, dass sich alle Minderheiten unsicher fühlen, wenn eine Regierung gegen einzelne Gruppen gezielt vorgeht. „Spillover-Effekt“, sagen Forschende. Ängste schwappen über. Eine Frage drängt sich auf: Sind wir die nächsten?
US-Präsident Trump gilt als einer der größten Verteidiger Israels unter Ministerpräsident Netanjahu. Er liefert Waffen im Kampf gegen Israels Gegner, vor allem den Iran. Er schwadroniert von einem „Trump Gaza“, in dem die USA das Gebiet der Palästinenser kontrollieren. Und Ivanka Trump, die älteste Tochter, heiratete einen orthodoxen Juden und konvertierte selbst zum Judentum. Ihr Vater kürzte drastisch die Förderung von Elite-Universitäten. Ein Vorwurf: Die Hochschulen gehen nicht stark genug gegen Antisemiten unter propalästinensischen Studierenden vor.
Das ist die eine Seite von Donald Trump. Eine, die Menschen wie George Nathan eigentlich Sicherheit geben sollte. Aber es gibt noch eine andere. Auf dieser Seite umgibt sich Trump mit Antisemiten, das zeigen Recherchen mehrerer Medien. Das ist etwa Paul J. Ingrassia, der in der aktuellen Administration einige Monate als Abgesandter des Weißen Hauses in zwei Ministerien arbeitete. Ingrassia hat laut Recherchen etwa enge Verbindungen zu Holocaust-Leugner Nick Fuentes.
Ohnehin stehen einige radikal Rechte Trump nahe, bis vor Kurzem unter anderem Elon Musk – mittlerweile ein Fan der AfD. Auf dem Weg an die Macht attackierte Trump „Eliten“ und „Globalisten“. Liberale Milliardäre wie George Soros gehören zu seinen Feindbildern, weil sie angeblich eine „neue Weltordnung“ planten. Es sind Felder antisemitischer Verschwörungsmythen, die Trump beackert. Der US-Präsident ist kein Antisemit, könne aber gleichzeitig „antisemitische Bedeutungsmuster“ propagieren, schreibt der Soziologe Leo Roepert.
Trumps Leitspruch „America First“ geht auf das Dogma von US-Flugpionier und Politiker Charles Lindbergh zurück – ein ausgewiesener Antisemit und Fan des Hitler-Regimes, wie der Politologe Lars Rensmann beschreibt.
Die Trump-Rhetorik schafft ein Klima, das Menschen wie George Nathan gefährlich werden kann – auch wenn es sich nicht gegen ihn persönlich richtet. Der Enkel des Holocaust-Verfolgten erzählt, wie die Synagoge seiner Gemeinde in Atlanta rund um die Uhr überwacht werde. Früher seien es ein, zwei Wachleute gewesen, heute stünden an Feiertagen acht oder zehn Bewaffnete vor dem Tor.
2018 erschoss ein weißer Lastwagenfahrer elf Menschen in einer Synagoge in Pittsburgh. Sein Motiv: Judenhass. Im Mai dieses Jahres tötete ein propalästinensischer Aktivist zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington.
Hasskriminalität nimmt zu, richtet sich gegen Israel und gegen jüdische Einrichtungen
George Nathan sagt: „Der Antisemitismus in den USA war noch nie so groß wie heute.“ Was er fühlt, bestätigen Umfragen. Nach Angaben der Anti Defamation League (ADL) stiegen die antisemitischen Vorfälle 2024 auf 9354 – ein neuer Rekord. Mehr als jeder zweite amerikanische Jude gibt an, er verändere das Verhalten in der Öffentlichkeit, aus Angst vor Angriffen.
Es ist ein beunruhigender Trend, der sich auch in Deutschland zeigt. Hasskriminalität nimmt zu, richtet sich gegen Israel und gegen jüdische Einrichtungen. Und die Unsicherheit unter Juden wächst mit.
Aus Hass in Worten werden Taten mit Toten. So ist es heute. So war es damals, im eisigen Winter 1941 im Ghetto von Riga. Die fehlenden Medikamente, der Hunger, die Todesangst, die schwere Zwangsarbeit – Georg Nathan, 62 Jahre alt, stirbt wenige Monate, nachdem die Nazis ihn und seine Familie deportieren, an einer Blutvergiftung im Lazarett.
Nathans Frau und die beiden Töchter, Emmi und Sophie, Georges Mutter, schaffen es. Die drei überstehen Ghetto, Todesmärsche, Lager. „Meine Oma war eine starke Frau“, sagt der Enkel heute. „Sie ist der Grund, warum sie überlebten.“

Warschauer Ghettoaufstand April/Mai 1943: Ein jüdischer Junge mit erhobenen Händen, Frauen und andere Kinder kommen aus einem von den deutschen Truppen eroberten Haus.
© Picture-Alliance | dpa
Diese Großmutter Thekla war es, die 1971 einen Brief an eine alte Nachbarin in Deutschland schickte. „Fast 30 Jahre sind vergangen, daß wir Emmerich verlassen mußten, aber wir haben hier eine neue Heimat gefunden.“ In den USA, wo jeder „gleich geachtet werde“, etwas „Wunderbares nach all den Jahren der Missachtung“.
Und so wird in dem Gespräch mit George Nathan auch deutlich, dass er sich nicht nur Deutschland verbunden fühlt. Sondern vor allem seiner Heimat USA. Die Einbürgerung ist ein „Rettungsanker“, wie er sagt, wenn die Zeiten sich ändern. Aber Nathan sagt auch: „Ich hoffe, ich werde ihn nie nutzen müssen.“
Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
Hinter den Kulissen der Politik – meinungsstark, exklusiv, relevant.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der
Werbevereinbarung
zu.
Die Geschichte der Nathans begann mit einem Foto. Sie soll mit einem Foto enden. Mai 2016, der Enkel, damals noch nicht deutscher Staatsbürger, steht gemeinsam mit seiner Frau vor dem Haus seines Opas in Emmerich am Rhein. Die Nachfahren der NS-Verfolgten sind zurück, auf Besuch. Der Enkel trägt eine helle Jacke, Sonnenbrille, Schiebermütze. Er lächelt, umarmt seine Ehefrau, die mit ihm hierhergereist ist. Ein Foto, das sich wie ein Ankommen anfühlt.

Vor dem einstigen Wohnhaus der Familie Nathan in Emmerich am Rhein sind nun Stolpersteine in den Weg eingelassen. In Gedenken an Thekla, Emmi, Sophie und Georg.
© privat | Privat
Die Adresse liegt im „Fischerort“, Hausnummer 17. Dort, in die graue Pflasterstraße eingelassen, glänzen vier goldene Steine. Kleine Denkmäler für die toten und überlebenden Opfer der Nazis.
Für Thekla, Emmi, Sophie.
Und für Georg Nathan, der Metzgerssohn und Viehhändler, der dem Deutschen Reich im Krieg an der Westfront diente – und den die Deutschen am Ende in das Ghetto deportierten und umbrachten.