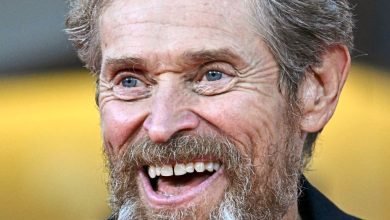Vorsicht bei der Pilzsuche: Warum eine Pilzvergiftung so schwer zu erkennen ist |ABC-Z

Nicht jeder Pilz ist leicht als Giftpilz zu identifizieren. Und auch die Symptome sind bei Betroffenen danach nicht immer eindeutig. Was man beim Pilze sammeln beachten sollte – und wieso Erkrankte ihr Erbrochenes sichern sollten.
Frische Speisepilze selbst sammeln – für viele Naturfreunde gehört das zum Spätsommer dazu. Die Deutsche Leberstiftung mahnt dabei jedoch zu besonderer Vorsicht. Unbekannte oder falsch bestimmte Pilze könnten lebensbedrohliche Folgen haben. Bereits der Verzehr eines einzigen Giftpilzes könne ein akutes Leberversagen auslösen.
Besonders gefährlich sei der Grüne Knollenblätterpilz, erklärt Markus Cornberg, Medizinischer Geschäftsführer der Deutschen Leberstiftung. Dieser Pilz sei hierzulande für mehr als 90 Prozent aller tödlich verlaufenden Pilzvergiftungen verantwortlich. Je nach Giftgehalt könne der Verzehr von fünf bis 50 Gramm tödlich sein – „bei Kindern und älteren Menschen können schon deutlich kleinere Mengen lebensgefährlich werden“.
Eine durch Giftpilze ausgelöste Lebervergiftung sei eine ernst zu nehmende medizinische Notlage, die mitunter tödlich enden könne. Zugleich seien Pilzvergiftungen aufgrund unterschiedlicher und mit zeitlicher Verzögerung auftretender Symptome oft nur schwer zu erkennen.
Beim Grünen Knollenblätterpilz etwa setzten Beschwerden oft erst viele Stunden nach dem Verzehr ein, wenn die giftigen Substanzen bereits über die Blutbahn in die Leber gelangt seien. Dort könnten sie schwerste Schäden bis hin zu akutem Leber- und Multiorganversagen verursachen.
Selbst gesammelte Pilze sollten nur dann verzehrt werden, „wenn man sich sehr gut auskennt und absolut sicher ist“, heißt es. Die Experten der Deutschen Leberstiftung raten nicht grundsätzlich vom Pilzsammeln ab, mahnen aber dringend zur Vorsicht und sorgfältiger Vorbereitung.
Wer einen Pilz bestimmen möchte, sollte sich nicht allein auf Bestimmungsbücher oder Apps verlassen. Viele Arten lassen sich dabei nicht eindeutig unterscheiden.
Vorsicht ist bei vermeintlich bewährten Methoden zur Unterscheidung essbarer und giftiger Pilze angebracht. Diese sind oft irreführend und unzuverlässig. Etwa die Behauptung, Verfärbungen von mitgekochten Silberlöffeln oder Zwiebeln würden auf Ungiftigkeit hinweisen. Das trifft nicht zu, ebenso wie die Behauptung, Fraßspuren von Tieren seien ein Beleg dafür, das ein Pilz essbar sei. Der für Menschen tödlich giftige Grüne Knollenblätterpilz werde beispielsweise von Schnecken problemlos vertragen.
Wer Pilze sammeln möchte, sollte sich im Vorfeld sehr gründlich informieren. Wer nicht über langjährige Erfahrung und fundiertes Pilzwissen verfügt, sollte unbedingt einen Experten, vorzugsweise einen Pilzsachverständigen, zurate ziehen – oder noch besser gleich auf geprüfte Speisepilze aus dem Handel zurückgreifen.
Unerfahrene Pilzsammler können bei einer geführten Exkursion mit einem Pilzexperten wichtige Tipps bekommen und sich Praxiswissen aneigenen.
Gesammelte Pilze sollten vor dem Verzehr von einem speziell ausgebildeten Pilzsachverständigen geprüft werden.
Die Website der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) bietet einen Überblick über Pilzsachverständige. Zudem richten viele Städte zur Pilzsaison spezielle Beratungs- und Kontrollstellen ein, an denen Fachleute Auskunft geben. Informationen zu diesen Angeboten gibt es bei der jeweiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung.
Wichtig ist es, die typischen Symptome einer Pilzvergiftung zu kennen. Dazu gehören unter anderem Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüche und Benommenheit. Wer entsprechende Anzeichen nach dem Pilzverzehr bemerkt, sollte umgehend ärztliche Hilfe aufsuchen oder den Notarzt rufen.
Auch die Kontaktaufnahme zu einem Giftinformationszentrum kann hilfreich sein. „Eine schnelle Behandlung ist entscheidend, da die Zersetzung des Lebergewebes mit der Zeit fortschreitet“, warnt die Deutsche Leberstiftung.
Viele Betroffene können sich im Ernstfall nicht mehr genau erinnern, welche Pilze sie gegessen haben. Um die Diagnose zu erleichtern, sollten Reste der Pilzmahlzeit zusammen mit eventuell vorhandenem Erbrochenem unbedingt gesichert und dem behandelnden Arzt übergeben werden.
KNA, dia