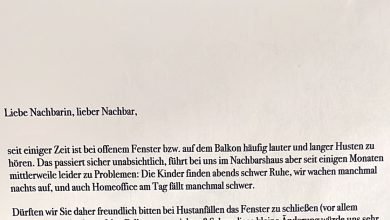Borkenkäfer vernichtet Südtirols Wälder – Experten warnen vor „Epidemie“ | ABC-Z

Knapp über die Hälfte der Südtiroler Landesfläche ist mit Wald bedeckt und große Teile davon erfüllen eine wichtige Schutzfunktion. Doch Borkenkäfer drohen diesen wichtigen Lebensraum zunehmend zu zerstören: Allein in den letzten vier Jahren haben die Schädlinge rund 38.000 Hektar Wald vernichtet – das entspricht der Fläche des Gardasees. Experten warnen mittlerweile vor einer regelrechten „Epidemie“.
Ein FUNKE Liebe
Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der
Werbevereinbarung
zu.
Borkenkäfer zählen zu den gefährlichsten Forstschädlingen. Sie befallen bevorzugt Fichten und können zu deren raschem Absterben führen, da sie den sogenannten Saftfluss der Bäume unterbrechen – die Nährstoffversorgung von den Nadeln bis zu den Wurzeln. Normalerweise befällt der Borkenkäfer nur einzelne, geschwächte Bäume. Gesunde und vitale Pflanzen schaffen es, den Schädling durch vermehrte Harzproduktion erfolgreich abzuwehren.
Lesen Sie hier, wie es den deutschen Wäldern laut Experten geht
Borkenkäfer-Plage: Förster setzen auf spezielle Fallen
Das massenhafte Auftreten der Borkenkäfer wird durch den Klimawandel begünstigt. Höhere Temperaturen, längere Dürren und das vermehrte Vorhandensein von Schadholz schaffen ideale Bedingungen für die Vermehrung der Schädlinge. Ein Schlüsselereignis war der Sturm Vaia im Oktober 2018, der große Teile des Alpenraums verwüstete und damit einen idealen Nährboden für die Käfer bereitete.
Zwischen dem 27. und 30. Oktober 2018 fegte Vaia mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h durch die Regionen Trentino-Südtirol, Venetien und Friaul-Julisch Venetien. Anhaltender Starkregen verstärkte die Schäden, die der Orkan in den Wäldern anrichtete. Ganze Berghänge wurden kahlgeschlagen, Straßen und Stromleitungen zerstört, und viele Orte waren tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Insgesamt zerstörte der Sturm rund 8,5 Millionen Kubikmeter Holz, vor allem Fichten – das entspricht etwa 14 Millionen Bäumen.
Um der Käferplage entgegenzuwirken, setzen Förster auf Pheromonfallen. Dabei werden die Insekten mit einem Duftstoff angelockt und gefangen. Anhand der Anzahl gefangener Käfer lassen sich Rückschlüsse auf die Population in einem bestimmten Gebiet ziehen. Außerdem brachten die niederschlagsreichen Monate im letzten Frühjahr einen Vorteil: Fichten, die besonders häufig vom Borkenkäfer befallen werden, konnten viel Wasser aufnehmen und waren deshalb widerstandsfähiger gegen einen Befall.
Borkenkäfer: Wiederaufforstung soll helfen
Die Borkenkäferplage hat im gesamten Alpenraum eine breite Diskussion über die Resilienz der Wälder, über nachhaltige Wiederaufforstung und über den Schutz sensibler Bergregionen ausgelöst. „Es bedarf ernsthafter Überlegungen zur Wiederaufforstung angesichts des Klimawandels. Die durchschnittlichen Temperaturen steigen auch im Alpenraum immer weiter. Jetzt geht es darum zu verstehen, wie wir die Wälder der Zukunft pflegen und gestalten müssen. Wir brauchen resilientere Wälder, die vielfältiger sind und nicht mehr aus reinen Monokulturen bestehen – wie es in der Vergangenheit der Fall war, als Fichten fast überall in den Alpen angepflanzt wurden“, erklärt Giovanni Sanesi, Dozent für Forstwirtschaft an der Universität „Aldo Moro“ in Bari.
„Früher galt die Fichte als besonders wirtschaftlich, da ihr Holz leicht nutzbar war – und deshalb wurden Baumarten wie Buche oder Weißtanne vielerorts verdrängt. Heute wissen wir, dass Bäume wie Buchen, Weißtannen oder Eichen deutlich widerstandsfähiger sind. Wir müssen genau lesen, was uns die Natur gerade zeigt – und der Zeit voraus sein. Es ist keine unmögliche Aufgabe, aber es braucht jetzt den Willen und Weitblick, um zu handeln“, schließt Sanesi.
Italien kämpft mit gleich mehreren Tierplagen, wie etwa der Blaukrabbe, die Urlauber an Stränden verjagt
In vielen Wäldern wurde das Schadholz inzwischen entfernt. An besonders steilen Hängen, beispielsweise im Südtiroler Passeiertal, werden abgestorbene Bäume gefällt und waagrecht liegen gelassen – dieses Verfahren nennt man „Querfällen“. Die liegenden Bäume bilden einen natürlichen Schutz gegen Erosion und Steinschlag. Gleichzeitig wird dadurch auch die natürliche Verjüngung des Waldes begünstigt.