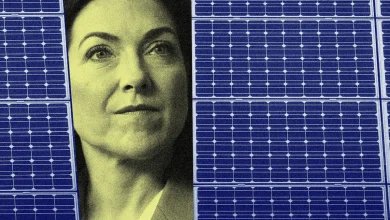Vermögen: Wer schon wenig hatte, ist jetzt noch ärmer | ABC-Z

Die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind
an den Finanzen der Deutschen nicht spurlos vorübergegangen. Vor allem durch die
hohe Inflation haben die Vermögen der Haushalte an Wert verloren. Allerdings
sind nicht alle gleich stark vom Anstieg der Preise in den vergangenen Jahren betroffen. Wie eine aktuelle Studie zeigt, sind vor allem die Vermögen ärmerer
Haushalte preisbereinigt geschrumpft.
Zwar sind die Vermögen der Menschen in
Deutschland nominal zwischen 2021 und 2023 im Schnitt leicht gestiegen, wie aus der
Befragung der Bundesbank hervorgeht, und zwar um 2,6 Prozent auf 324.800 Euro. Inflationsbereinigt
ergab sich jedoch ein Rückgang von elf Prozent. Bei der ärmeren Hälfte der
Bevölkerung waren es sogar mehr als 20 Prozent. Ein Grund dafür ist, dass es sich bei
den Vermögen von ärmeren Menschen größtenteils um Spareinlagen handelt, die an
Wert verlieren, wenn die Preise steigen.
Die Bundesbank hat im Jahr 2023 insgesamt rund 4.000
Haushalte in Deutschland zu ihrem Vermögen befragt, und das bereits zum fünften
Mal. Neben Bankguthaben, Lebensversicherungen und Aktien
wurden auch Immobilien und Firmenbeteiligungen einbezogen. Nicht berücksichtigt
wurden Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Schulden wurden
abgezogen.
Im Ergebnis zeigt sich: Die Vermögen in Deutschland sind weiterhin
sehr ungleich verteilt. Es gibt keinen eindeutigen Trend hin zu einer höheren oder niedrigeren Ungleichheit. Zwar konnte die obere Mitte ihren Anteil
am Gesamtvermögen etwas steigern. Dennoch besitzen die reichsten zehn Prozent weiterhin mehr als die
Hälfte des Gesamtvermögens in Deutschland. Der Anteil der ärmeren Hälfte der
Bevölkerung ist weiterhin extrem gering und liegt bei lediglich 2,9 Prozent. Auch im internationalen Vergleich bleibt die Vermögensungleichheit hoch. Im Euroraum gehen
die Vermögen lediglich in Österreich noch weiter auseinander.
Nach wie vor lassen sich in Deutschland große regionale Unterschiede
erkennen. Obwohl die durchschnittlichen Vermögen im Osten zwischen 2021 und
2023 nominal stark gestiegen sind, liegen sie mit 170.100 Euro im Schnitt noch
deutlich unter denen im Westen (364.900 Euro). Eine wichtige Rolle spielt dabei,
dass im Osten mit 29 Prozent nach wie vor deutlich weniger Menschen
Wohneigentum besitzen als im Westen. Dort sind es 45 Prozent. In den
westdeutschen Bundesländern sind die Vermögen vor allem im Süden besonders hoch.
Wie aus der Befragung der Bundesbank hervorgeht, ist
Immobilienvermögen vor allem bei den reicheren Haushalten vorhanden. Betriebsvermögen
fallen nur bei den obersten zehn Prozent ins Gewicht. Bei der ärmeren Hälfte sind
Wertgegenstände wie Autos von größerer Bedeutung. Je höher das Vermögen, desto
größer ist der Anteil risikoreicher Anlageformen wie Wertpapieren und stillen
Beteiligungen an Unternehmen. Die unterschiedliche Besitzstruktur befeuert die Ungleichheit, da die Anlageformen unterschiedliche
Wertsteigerungen bringen. So sind die Immobilienpreise nach einem
jahrelangen Anstieg zwischenzeitlich stark gefallen. Wer sein Geld ausschließlich
auf dem Bankkonto ließ, machte Verlust, da die Inflation die Geldanlage entwertete. Die Aktienkurse können zwar stark schwanken, wie aktuell aufgrund der
Zollpolitik von Donald Trump. In der Regel lassen sich mit Wertpapieren aber
höhere Renditen als mit Sparguthaben erzielen.
Davon wollen in Deutschland immer mehr Menschen profitieren.
Der Anteil der Haushalte, die in Aktien und Fonds investieren, ist zwischen 2017 und 2023
von elf auf achtzehn Prozent gestiegen. 24 Prozent halten Fondsanteile. Die
Entwicklung dürfte unter anderem auch auf die Pandemie zurückzuführen sein, als
die Menschen weniger Geld zum Beispiel für Reisen ausgaben und mehr zum Sparen
zur Verfügung hatten. Vor allem junge Anlegerinnen und Anleger wagten den Schritt an die Börse. Das
gute alte Sparbuch ist aber nach wie vor beliebt, 67 Prozent der Haushalte
setzen immer noch darauf. Ein Großteil des Vermögens in Deutschland wird immer noch
auf Bankkonten beziehungsweise risikoarm angelegt.
An den Sparmotiven der Deutschen hat sich derweil nicht
sonderlich viel geändert. Die meisten wollen für Notsituationen, größere Anschaffungen
und das Alter vorsorgen. Außerdem wird wieder mehr für Urlaub und Reisen gespart
als während der Pandemie und etwas weniger für Immobilien, was an den gestiegenen Finanzierungskosten liegen könnte. Rund 83 Prozent der Haushalte gaben an, zumindest
gelegentlich zu sparen. Das sind etwas weniger als noch während der Pandemie,
aber mehr als davor. Es gibt auch Menschen in Deutschland, die nicht
genügend verdienen, um Geld zurückzulegen: 13 Prozent gaben an, ihnen fehlten
die finanziellen Mittel. Vier Prozent wollen nicht sparen.
Verschuldet sind 39 Prozent der Haushalte, ihr Anteil ist
leicht gesunken. Im Jahr 2021 hatten noch 41 Prozent der Haushalte
ausstehende Schulden, im Jahr 2017 waren es 45 Prozent. Die Autoren der
Studie vermuten, dass die Entwicklung womöglich auf die Coronapandemie
zurückzuführen ist. Eventuell greifen die Haushalte verstärkt auf Guthaben
zurück, die sie während der Pandemie aufbauen konnten, statt neue Kredite
aufzunehmen. Dazu kommt, dass Bankkredite durch die gestiegenen Zinsen
unattraktiver geworden sind.