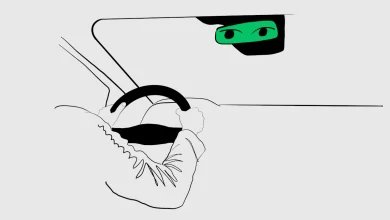Unicredit-Chef Orcel zu Commerzbank-Übernehmen: „Ich habe schon oft gehört, dass etwas nicht geht“ | ABC-Z

Wir haben diesen gesamten Prozess unter völlig anderen Umständen begonnen. Hätte ich damals schon gewusst, wie sie sich ändern würden, hätte ich gezögert. Denn, glauben Sie mir, auf den ganzen Ärger, den es zuletzt deswegen gab, hätte ich gern verzichtet. Andererseits glaube ich nach wie vor an das Potential einer Fusion dieser beiden Unternehmen. Gleichzeitig befinden wir als Unicredit uns nach wie vor in einer sehr guten Position.
Wir hatten zu der Zeit starke Signale des Managements und hochrangiger Regierungsvertreter, dass sie offen waren und dass sich die Regierung gegenüber unserem Vorhaben zumindest neutral verhalten würde. Wir fanden auch, es sei im Interesse beider Banken – und übrigens auch im Interesse Deutschlands und Europas. Wir brauchen auf unserem Kontinent nun einmal starke Banken. Damals hatten wir eigentlich erwartet, mit der Commerzbank in einen offenen Dialog über die Zukunft einzutreten, aber der wurde uns verweigert. Natürlich hätten wir unseren Anteil dann auch wieder verkaufen können. Aber das hätte wie ein Eingeständnis ausgesehen, dass wir etwas falsch gemacht hätten. Und das haben wir nicht.
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sagt, sie wolle erst mit Ihnen reden, wenn Sie ein förmliches Übernahmeangebot gemacht haben.
Bettina und ich haben ein professionelles Verhältnis. Wir sehen uns hin und wieder auf Konferenzen und grüßen uns freundlich. Und Unicredit wird auch mit einem Anteil von mittlerweile rund 26 Prozent behandelt wie ein normaler Investor. Das heißt: Wir sind bei den üblichen Investorengesprächen dabei, die der Commerzbank-Vorstand mit uns und anderen Anlegern führt. Wir bringen unsere Standpunkte formell zum Ausdruck. Ich würde mir nur wünschen, dass wir uns einfach an einen Tisch setzen und gemeinsam auf die Fakten und die Möglichkeiten schauen, die so ein Zusammenschluss bereithält. Leider geschieht das im Moment nicht.
Sie erwecken den Eindruck, kommunikativ alles richtig gemacht zu haben. Haben Sie sich gar nichts vorzuwerfen?
Ich betreibe dieses Geschäft seit 30 Jahren: Wir waren immer klar in unserem Ansinnen und haben immer das geliefert, wozu wir uns verpflichtet haben. Um es einmal umzudrehen, frage ich Sie: Wenn wir den Commerzbank-Aktionären ein formales Übernahmeangebot machen würden, wie es das Gesetz nach der Schwelle in Höhe von 30 Prozent der Anteile vorschreibt – wie würde man das wohl nennen? Alle würden sagen, das sei ein feindliches Übernahmeangebot. Wenn man sich aber weigert, im Vorhinein mit uns zu sprechen – was tue ich dann, wenn die Aktionäre beider Seiten überzeugt sind, dass es in ihrem Interesse liegt, und von mir erwarten, dass ich es mache?
Wird es dazu kommen? Wie wahrscheinlich ist eine Übernahme aus Ihrer Sicht jetzt noch?
Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Und es geht mir wirklich nicht darum, Ihrer Frage auszuweichen.
Sie waren in Ihrer Laufbahn in einige Bankenfusionen involviert. Was macht es dieses Mal so schwierig?
Übernahmen waren früher vergleichsweise einfach. Man hat mit der anderen Seite die Fakten debattiert und sich auch manchmal gestritten, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Heute allerdings geht es mehr darum, wie die eine oder die andere Seite die Dinge wahrnimmt. Das meine ich gar nicht speziell auf die Commerzbank bezogen, das ist die allgemeine Entwicklung in Europa in den vergangenen zwanzig Jahren. Die Vorstandsteams positionieren sich heute offener für oder gegen eine Übernahme, dabei ist das nicht ihre Aufgabe. Es ist ihre treuhänderische Pflicht, diese Entscheidung ihren Eigentümern, also den Aktionären, zu überlassen. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir aufseiten der Regierungen, die viel stärker schon im Vorhinein Position beziehen. Es ist richtig, dass sie sich um Dinge wie die Stabilität des Bankensystems sorgen. Wenn allerdings verhindert wird, dass aus zwei Banken, die gut zueinander passen, eine stärkere Bank gebildet wird, dann sollten wir das als schwierig erachten.
Ich denke, es ist zu früh, etwas dazu zu sagen. Ob jemand gute Arbeit leistet, können Sie im Bankgeschäft nicht nach drei, vier Quartalen beurteilen. Das geht frühestens nach drei oder vier Jahren. Wenn in einer solchen Situation wie zuletzt ein neues Management ins Amt kommt, hat dieses ein paar Möglichkeiten, an einigen kurzfristigen Schrauben zu drehen, um die Bank besser aussehen zu lassen. Es kann die ganze Bank in eine Art Alarmzustand versetzen und etwas aggressivere Finanzziele formulieren. Irgendwann allerdings kommt der Punkt, an dem man wirklich etwas verändern muss. Das ist echte Transformation. Ob es dazu in der Commerzbank wirklich schon gekommen ist, lässt sich jetzt noch nicht sagen.
Versuchen Sie gerade, den Aktienkurs der Commerzbank schlechtzureden?
Nein, ich sage nur, dass ein paar gute Quartale noch keine Aussage über die langfristige Performance zulassen. Die echte Arbeit fängt jetzt erst an. Wir wollen, dass der Aktienkurs sich gut entwickelt, weil wir davon profitieren. Aber eben nur, wenn dahinter auch nachhaltiges Wachstum steht.

Könnte es nicht auch sein, dass es Sie ärgert, dass sich der Kurs so gut entwickelt hat? Das macht Ihre Übernahmepläne teurer.
Unicredit befindet sich genau an dem Punkt, den wir für diesen Zeitpunkt angekündigt hatten, und ist momentan in einer sehr komfortablen Position. Uns gehören demnächst fast 30 Prozent der Commerzbank. Wir haben die Aktie zu einem niedrigen Kurs gekauft, und die Rendite unserer Investition wird 20 Prozent betragen – eine Rendite, die man bei der heutigen Bewertung nirgendwo auch nur annähernd erzielen könnte. Das ist hervorragend. Wir haben Zeit und können abwarten, wie sich die Dinge entwickeln werden.
Einen Sitz im Aufsichtsrat der Commerzbank streben Sie nicht an?
Wenn die Bank sich weiter in die richtige Richtung entwickelt, gibt es keine Notwendigkeit dazu. Wenn die Bank allerdings in die falsche Richtung unterwegs ist, dann stellt sich die Frage womöglich und dann müsste man darüber nachdenken. Schließlich wäre dann zu erwarten, dass die Unicredit-Aktionäre sich bemerkbar machen und das verlangen würden. Dafür habe ich Verständnis, wir haben ja Milliarden in die Commerzbank investiert – und wir wären damit nicht allein. Alle anderen institutionellen Anleger würden Informationen verlangen.
Wann würden die Unicredit-Aktionäre die Geduld mit Ihnen verlieren?
Ich weiß, wem ich meine Position verdanke. Wenn die Aktionäre zu der Auffassung kämen, dass Unicredit einen anderen Kurs einschlagen müsste, wäre ich der Letzte, der sich dem verweigern würde. Derzeit habe ich den Eindruck, dass die überwältigende Mehrheit sehr zufrieden ist. Denn unser Commerzbank-Anteil ist deutlich mehr wert als zum Zeitpunkt des Einstiegs, die Aktionäre profitieren überdies von höheren Ausschüttungen und der weiter bestehenden Chance auf einen aussichtsreichen Zusammenschluss in der Zukunft. Sollten sie allerdings genug von der Sache bekommen, könnte ich unseren Commerzbank-Anteil auch einfach mit Gewinn wieder verkaufen.

Interessante Frage. Was würde passieren, wenn eine Bank, die nicht aus der EU stammt, am meisten für unsere Anteile bieten würde? Dann müsste ich aus Verpflichtung meinen Aktionären gegenüber diese Offerte annehmen. Würde mir das gefallen? Nicht unbedingt, ich versuche ja seit einem Jahr, eine noch stärkere Bank in Europa zu schmieden. Aber wenn dies nicht gewünscht ist, gelten selbstverständlich die Regeln der freien Marktwirtschaft.
Auch die neue Bundesregierung lehnt Ihr Übernahmevorhaben ab. Haben Sie zu wenig das Gespräch mit ihr gesucht?
Wir haben zu jedem Zeitpunkt unsere Gesprächsbereitschaft signalisiert. Ich habe mir angewöhnt, nicht darüber zu spekulieren, warum eine Regierung eine bestimmte Meinung hat, und ich will an dieser Stelle auch ganz klar sagen: Die Regierung hat natürlich jedes Recht dazu. Die Bankbranche ist wichtig, und Veränderungen dort können größere Auswirkungen haben. Nur ein Argument kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Es heißt jetzt häufig, dass ohne eine Vollendung der Regeln zur Bankenunion keine länderübergreifenden Zusammenschlüsse von Banken in Europa möglich seien. Das Argument ist auf diese Situation nicht anwendbar. Denn im Kern ginge es ja darum, die Commerzbank mit der deutschen Tochtergesellschaft der Unicredit – der Hypovereinsbank – zu verschmelzen. Aus meiner Sicht wäre das eine deutsch-deutsche Fusion.
Vielleicht sorgt sich die Politik auch wegen der italienischen Staatsanleihen in den Büchern der Unicredit.
Schauen Sie bitte auf die Zahlen! Das Europa aus den Zeiten der Eurokrise ist nicht mehr das Europa von heute. Viele italienische Banken haben eine bessere Ausstattung mit Eigenkapital als deutsche Institute. Und Unicredit steht bei so gut wie allen Risikokennziffern besser da als die Commerzbank. Die Bank hat eine gute Entwicklung gemacht, das gestehe ich zu. Allerdings von einem viel niedrigeren Niveau aus. Erst unser Auftauchen hat doch dazu geführt, dass die Commerzbank Veränderungen angestoßen hat.
Herr Orcel, Sie sind 62 Jahre alt, haben viel Geld verdient und könnten es darum auch etwas ruhiger angehen lassen. Was motiviert Sie?
Zwei Dinge. Erstens liebe ich Herausforderungen. Sie glauben nicht, wie oft ich schon gehört habe, dass etwas nicht gehen würde. Meine Überzeugung ist: Ein gutes Team kann gemeinsam Grenzen verschieben. Das möchte ich wieder und wieder unter Beweis stellen. Der zweite Punkt hat mit meiner Tochter zu tun. In der Finanzkrise kam sie einmal zu mir und sagte: „Papa, jemand in der Schule hat behauptet, alle Banker seien schlechte Menschen.“ Das hat mir das Herz gebrochen. Da habe ich mir vorgenommen, ihr und allen zu zeigen, dass das Bankwesen etwas Gutes bewirkt.