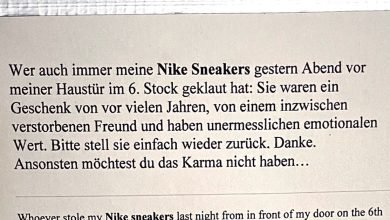FLI-Expertin zur Vogelgrippe: “In Geflügelhaltungen vermehrt sich das Virus besonders gut” | ABC-Z
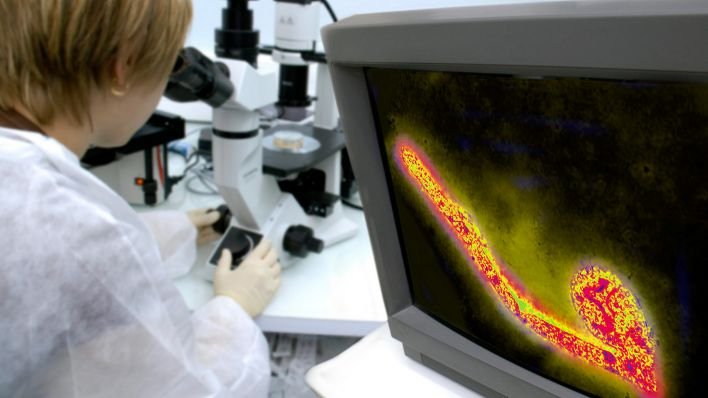
Interview | Vogelgrippe
–
“In Geflügelhaltungen vermehrt sich das Virus besonders gut”
Das derzeit grassierende Vogelgrippe-Virus ist hoch wandlungsfähig und neigt zu Mutationen. In Geflügelhaltungen vermehrt es sich besonders gut. Eine Impfung ist nur unter Vorbehalt einsetzbar, so die Biologin Elke Reinking vom Friedrich-Loeffler-Insitut.
rbb|24: Hallo Frau Reinking. Ist die Massentierhaltung Treiber für solche Viren wie das derzeitige H5N1-Vogelgrippe-Virus?
Elke Reinking: Das hochpathogene aviäre Influenzavirus H5N1 – also das Geflügelpestvirus – ist Mitte der 90er Jahre in Südostasien durch eine Art Pingpong von Wildenten und Geflügelhaltung entstanden. Wildenten sind in einer gering krankmachenden Form natürliche Träger solcher aviären Influenzaviren – also Vogelgrippeviren. Wenn diese Viren in Geflügel gelangen, können sie dort mutieren zur hochpathogenen Form. Insbesondere Hühner und Puten sind sehr empfänglich für eine Infektion.
In China ist damals ein solches hochpathogenes Virus wieder zurück in den Wildvogelbereich gekommen. Das hatte man vorher in diesem Ausmaß noch nicht gesehen. Von da aus hat das Virus mit den Wildvögeln seinen weltweiten Siegeszug angetreten. Bisher sind nur Australien, Neuseeland und Ozeanien nicht betroffen.
Doch das H5N1-Virus, mit dem wir es jetzt zu tun haben, ist nicht mehr das gleiche wie damals. Denn diese Influenza-Viren verändern sich ständig weiter, mutieren und sie treten immer wieder in anderen Varianten auf.
Sind durch die Massentierhaltung Mutationen eher möglich?
In Geflügelhaltungen – gerade bei Puten und Hühnern – vermehrt sich das Virus besonders gut. Da sind Anpassungen möglich. In den letzten Jahren hat sich das Virus aber auch oft an bestimmte Wildvogelarten angepasst. Mal an Möwen, mal an bestimmte Gänsearten. Es ist also nicht auf Geflügel beschränkt. Dennoch sollte man generell vermeiden, dass sich Geflügel infiziert. Auch aufgrund der hohen Wandlungsfähigkeit und der Neigung zu Mutationen des Virus.
Unter welchen Umständen könnte das derzeitige Virus Menschen in größerem Stil infizieren?
Die Variante bis 2015/16, die hauptsächlich aus dem asiatischen Bereich kam und die gerade dort und auch in Ägypten auch für viele Humaninfektionen gesorgt hat, war deutlich zoonotischer (Anm. d. Red.: Erkrankungen, die von Tieren auf den Menschen und umgekehrt übertragbar sind.) und hatte damit ein höheres Potential auch den Menschen zu infizieren. Doch es ist nach wie vor ein Vogelvirus.
Das Potential, den Menschen zu infizieren ist bei den verschiedenen Varianten etwas unterschiedlich. Um jetzt den Menschen besser infizieren zu können, müsste es noch mehrere Hürden überwinden. Dafür sehen wir im Moment anhand der Erbgutanalysen und der Sequenzanalysen keine Hinweise.
Aber Säugetiere sollen ja durchaus schon betroffen sein?
Säugetiere sollten sich möglichst nicht infizieren. Jeder Übertrag auf Säugetiere oder die Weiterverbreitung innerhalb einer Säugetierpopulation kann dazu führen, dass sich das Virus weiter an Säugetiere anpasst. Dann würde der Schritt zum Menschen eventuell auch etwas kleiner. Beziehungsweise hinge das auch davon ab, um welche Tiere es sich handelt. Bei Nutztieren würde das Virus dann auch dichter an den Menschen heranrücken. Das sollte vermieden werden.
Es gibt für die Tiere theoretisch Impfungen. Wäre das eine Lösung?
In Südostasien ist das schon passiert. Gerade auch vor dem Hintergrund der H5N1-Variante in den 2000er Jahren, die zoonotischer war. Damit wollte man den Virusdruck rausnehmen und die Humaninfektionszahlen senken.
In Europa ist es mittlerweile rein rechtlich auch möglich, zu impfen. Lange war das verboten. Doch da sich die Situation seit 2021/22 dahingehend so verändert hat, dass wir das Virus das ganze Jahr über niederschwellig sehen bei Wildvögeln und einzelnen Geflügelpest-Ausbrüchen, müsste man überlegen, für welche Geflügelarten und Haltungsformen eine Impfung eine Option sein kann.
In Frankreich wurden 2023 die – überwiegend im Freiland gehaltenen – Enten- und Gänsebestände geimpft. Dabei ist allerdings einiges zu beachten. Denn der Impfstoff bringt keine sterile Immunität. Man muss also trotzdem fortlaufend kontrollieren, ob trotz der Impfung eine Infektion mit dem Virus vorliegt. Denn die Tiere zeigen durch die Impfung keine Krankheitssymptome – und Enten und Gänse sind ohnedies ein bisschen unempfindlicher, was das angeht. Also muss man aufpassen, dass es unter der sogenannten Impfdecke nicht doch infizierte Tiere gibt, die das Virus auch ausscheiden. Das heißt, man braucht ein – auch finanziell – aufwändiges Überwachungsprogramm. Frankreich hat da allein für die Enten über hundert Millionen Euro ausgegeben.
Außerdem war zu lesen, dass verschiedene Länder dann den Import der Tiere verbieten könnten.
Das Problem ist tatsächlich, dass wenn geimpft wird, Drittländer häufig sofort den Import sämtlicher Geflügelprodukte einstellen. Das ist Frankreich auch passiert. Als man dort anfing, Enten und Gänse zu impfen, haben die USA einen Tag später verfügt, keine Geflügelprodukte aus Frankreich mehr einzuführen. Da hat man trotz der Impfung die Sorge, sich das Virus ins Land zu holen.
Davon abgesehen: eignet sich die Impfung für alle Tiere?
Aus wissenschaftlicher Sicht wäre zum Beispiel in Deutschland zu überlegen, ob man – mit den entsprechenden Maßnahmen – eben auch Enten und Gänse impft, die auch im Freiland gehalten werden.
Für beispielsweise Masthähnchen eignet sich die Impfung nicht. Das wäre viel zu aufwändig. Und auch die Lebensspanne der Tiere (Anm. d. Red.: in konventioneller Masthaltung beträgt das Alter der Tiere bei der Schlachtung 30-35 Tage) ist dafür viel zu kurz.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24
Sendung: Fritz, 28.10.2025, 13:30 Uhr