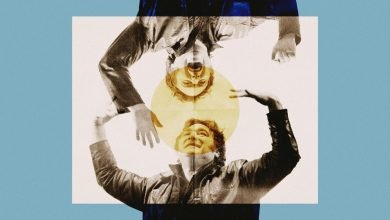Rüstungskonzern Ariane Group über die Verteidigung Europas | ABC-Z

Neben der Ariane 6 stellen wir heute bereits Treibstoffe und Ausrüstungen für Raketenantriebe sowie Verbundwerkstoffe für die europäische Verteidigungsindustrie her. Ariane Group ist nicht nur bereit, mehr zu produzieren, sondern auch neue Waffensysteme zu entwickeln, um auf neue Bedrohungen durch ballistische Raketen und Hyperschallsysteme zu reagieren. In diesem Kontext haben wir einen Demonstrator für einen Hyperschallgleiter getestet, V-MAX.
Es geht also um Flugkörper, die nach dem Start steil ins All aufsteigen, ehe sie mit rasanter Geschwindigkeit auf ihr Ziel auf der Erde schießen und in puncto Reichweite und Durchschlagskraft ein hohes Abschreckungspotential haben.
Klar ist: Abschreckung hat in Frankreich einen strikt defensiven Charakter. Die von Ariane Group gebaute ballistische M.51-Rakete an Bord von französischen U-Booten bildet das Rückgrat von Frankreichs nuklearer Abschreckung. Mit der französischen Beschaffungsbehörde haben wir gerade einen Vertrag für die vierte Weiterentwicklung der M.51 unterzeichnet. Ariane Group ist heute der einzige europäische Hersteller von ballistischen Raketen. Im neuen strategischen Umfeld in Europa könnten wir gefragt werden, die europäische Verteidigung mit dem Bau konventioneller Raketen zu verstärken.
Wie groß ist das deutsche Interesse?
Verschiedene europäische Länder haben großes Interesse an konventionellen ballistischen Raketen geäußert, insbesondere Deutschland. Die Entscheidung liegt natürlich beim französischen Staat. Er kontrolliert die Technologie und entscheidet über einen etwaigen Start eines Kooperationsprogramms dieser Art. Wenn sich Frankreich und Deutschland verständigen, dann wäre Ariane Group als ein deutsch-französisches Unternehmen mit Standorten in beiden Ländern zu einem Zusammenschluss rund um ein solches Projekt in der Lage.
Wann wäre das System lieferbar?
Das könnte im kommenden Jahrzehnt sein, noch ist aber keine Entscheidung gefallen. Die genaue Verfügbarkeit hängt von den Spezifikationen, Anforderungen und Modalitäten einer eventuellen Partnerschaft ab.
Ursprünglich hatte man im Rahmen des deutsch-französischen Ministerrats Ende August Ankündigungen über neue Waffensysteme erwartet. Bremsen die politische Krise und die Haushaltsprobleme in Frankreich die Entwicklung?
Der mehrjährige Planungsrahmen für die französischen Verteidigungsausgaben wird aktuell überprüft. In diesem Kontext laufen die Diskussionen, und bis Ende dieses Jahres könnte es grünes Licht für die Entwicklung konventioneller ballistischer Raketen geben. Politisch ist die Lage in Frankreich kompliziert. Trotzdem wurde Ende August die Weiterentwicklung der M.51 bekannt gegeben, um die Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung in den kommenden Jahrzehnten zu gewährleisten. Das bedeutet also, dass der Staat funktioniert und strategische Entscheidungen trifft.
Sehen Sie auch Möglichkeiten für eine gemeinsame europäische Abschreckung im nuklearen Bereich, wo sich die USA zunehmend aus Europa zurückziehen?
Darüber muss die Politik entscheiden. Ich stelle nur fest, dass sich die französische Position in Bezug auf die europäische Dimension nicht wesentlich verändert hat. Was sich stark verändert hat, ist die deutsche Antwort mit den Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz. Ich beobachte das mit Interesse. Und was sich auch verändert hat, ist die Wahrnehmung von Ariane Group. Früher sprach man nur über unsere Aktivitäten für die europäische Trägerrakete Ariane, heute auch über unsere Aktivitäten im Dienst der Abschreckung in Frankreich.
Wäre technisch und industriell eine gemeinsame europäische Abschreckung möglich?
Wenn wir eines Tages gebeten werden, etwas zu tun, werden wir darüber nachdenken.
Welchen Beitrag kann Ariane Group zur Verteidigung Europas im All leisten?
Mit der Ariane 6 kann Europa Satelliten ins All schicken, ohne die Genehmigung einer anderen Macht einholen zu müssen. Ariane 6 wurde für den Start der künftigen Bundeswehr-Satelliten SatComBW ausgewählt. Dieses starke Signal zeigt, dass Deutschland unsere Vision von Souveränität teilt. Daneben stellen die 35 Teleskope unseres Weltraumüberwachungsdiensts Helix sicher, dass Satelliten dort sind, wo sie sein sollen. Die Bedrohung im Weltraum nimmt zu.
Wir haben mehrfach Aktivitäten von fremden Satelliten festgestellt, die sich europäischen Satelliten gefährlich nähern, und wir sehen viele Objekte, die nicht standardmäßig klassifizierbar sind. Es ist wichtig, dass Europa sich mit Kapazitäten ausstattet, um genaue Informationen darüber zu erhalten, was dort oben vor sich geht. Aus diesem Grund führen wir mit Deutschland Gespräche über die Nutzung von Helix. Zudem unterzeichnen wir diese Woche mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum eine Absichtserklärung für stärkere Forschungsanstrengungen in der Weltraumüberwachung.
Angesichts der wachsenden Bedrohungslage engagiert man sich auch auf NATO-Ebene zunehmend im Weltraum. Was folgt daraus aus Ihrer Sicht für Europa?
Das Bewusstsein, dass der Weltraum für die Verteidigung absolut entscheidend ist, ist aus meiner Sicht in Europa stark gewachsen. In gewisser Weise ist der Krieg in der Ukraine ein Stellungskrieg, aber zusätzlich mit Weltraum. Der EU-Kommissar Andrius Kubilius sagt zu Recht immer, dass es ohne Weltraum keine Verteidigung gibt. Das gilt für Aufklärung, sichere Kommunikation sowie die Steuerung von Drohnen oder ballistischen Raketen. Trotzdem müssen wir in Europa noch weitergehen.
Wir brauchen eine europäische Präferenz. Nur in Europa wird in Betracht gezogen, für den Start von Militärsatelliten auf Trägerraketen aus anderen Weltregionen zurückzugreifen. Das gibt es in den USA nicht, das gibt es in China nicht, das gibt es in Russland nicht. Es zeugt also von einer gewissen Naivität, keine europäische Präferenz einzuführen. Das erschwert es, eine robuste Raumfahrtindustrie in Europa aufzubauen. Auch wenn ich den Nutzen des Wettbewerbs sehe, weil er Innovationen beschleunigt, denke ich, dass die richtige Lösung in der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene liegt. Unsere Budgets im Weltraumsektor sind siebenmal geringer als in den USA. Wir müssen wieder zu einer Dynamik der europäischen Zusammenarbeit im Weltraum finden. Ich hatte mit Trumps Wiederwahl und angesichts der geopolitischen Entwicklungen erwartet, dass sich diese Dynamik beschleunigt.
… und wurden enttäuscht?
Es gibt noch viel zu tun. Ein wichtiger Termin ist die Ministerkonferenz der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in Bremen im November. Die Zusammenarbeit ist meiner Meinung nach verbesserungsfähig, und es muss Geld in die europäische Raumfahrt gesteckt werden. Das ist wichtig für den langfristigen Betrieb der Ariane 6, aber auch für viele ESA-Programme, die für die Sicherheit wichtig sind.
Nun litt Europa aber auch unter der jahrelangen Verspätung der Ariane 6, die statt 2020 erst 2024 zu ihrem Erstflug abhob.
Richtig, Europa hat gelitten. Tatsache ist aber auch, dass die Ariane Group als federführendes von 900 Unternehmen in 13 Ländern, die an der Ariane 6 beteiligt sind, die Trägerrakete im Juli 2024 erfolgreich auf die Startrampe gebracht hat und die Inbetriebnahme bislang bemerkenswert ist. Bis Ende dieses Jahres stehen noch zwei Flüge an. Danach werden wir fünf Flüge in 18 Monaten absolviert haben. Das war bei keiner der vorherigen Ariane-Raketen der Fall und ist auch im Vergleich zu anderen Trägerraketen, die weltweit in Betrieb genommen werden, ein sehr guter Wert. Unser Ziel ist es, die Produktionsrate im kommenden Jahr zu verdoppeln und uns bis 2027 dem Ziel von neun bis zehn Starts im Jahr anzunähern. Derzeit liegen wir im Zeitplan.
Lässt sich die Zahl der Starts noch erhöhen?
Im Bereich der Booster sind wir aktuell auf neun bis zehn Starts im Jahr begrenzt. Wir prüfen, ob wir höher gehen können, angesichts des dafür notwendigen Baus neuer Fabriken wäre dies aber erst in einigen Jahren möglich.
Ganz im Gegenteil! Derzeit haben wir einen Auftragsbestand von 30 Starts, und wir haben noch Platz. Die Ariane 6 ist in der Lage, sämtliche europäische Satellitenkonstellationen in den kommenden Jahren ins All zu befördern.