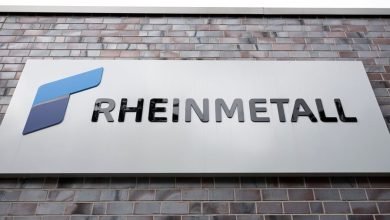Ukraine-Hilfe: Showdown zwischen Merz und De Wever | ABC-Z

Einmal wurde kurz gelacht an diesem Tag der Konfrontation in Europa. Am Donnerstagmorgen war das, kurz nach neun Uhr. Während die Staats- und Regierungschef im Gebäude des Europäischen Rats eintrudelten, saß der belgische Ministerpräsident in seinem Parlament, anderthalb Kilometer entfernt, und trug dort all seine Bedenken über ein Reparationsdarlehen für die Ukraine vor.
Für seine harte Haltung bekam Bart De Vewer viel Lob von den anderen Parteien, von einem Abgeordneten der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien auch auf Deutsch. De Wever antwortete ihm in derselben Sprache: „Leider sind nicht alle Deutschsprachigen so freundlich wie Sie.“ Heiterkeit im Plenarsaal, die Anspielung hatten die Abgeordneten verstanden.
Wer aus De Wevers Sicht nicht so freundlich war: Friedrich Merz. Der Bundeskanzler trat fast zur selben Zeit im Ratsgebäude vor die Kameras. Schnörkellos auch er: Er wolle die in Europa gesperrten Vermögenswerte der russischen Zentralbank nutzen, um die Ukraine weiter zu finanzieren. Er verstehe die belgischen Bedenken, sagte Merz. Trotzdem: „Aus meiner Sicht ist das die einzige Option.“ Dann folgte noch ein entscheidender Satz. „Wir stehen im Grunde vor der Wahl, europäische Schulden oder russisches Vermögen für die Ukraine einzusetzen, und da ist meine Meinung klar: Wir müssen das russische Vermögen nutzen.“
Belgien suchte nach einer alternativen Lösung
Das brachte den politischen Konflikt des Tages auf den Punkt. Auf der einen Seite jene, die wie Merz die gesperrten 210 Milliarden Euro einsetzen wollten, um der Ukraine einen Kredit zu geben und so ihren Abwehrkampf gegen Russland weiter zu finanzieren und Löcher in ihrem Haushalt zu stopfen – die größere Gruppe.
Auf der anderen Seite De Wever und ein paar Verbündete, denen das zu risikoreich erschien. Dem Belgier, weil er die Rache Russlands fürchtete: Enteignungen, hybride Angriffe. Italien, Bulgarien, Malta, weil ihnen das Risiko zu groß war, mit nationalen Garantien dafür einzustehen, dass das Geld im Fall des Falles doch an Moskau zurückgezahlt werden muss. Und die deshalb die Kommission aufgefordert hatten, eine Lösung zu suchen, bei der sie selbst Schulden für Kiew aufnimmt, die nicht auf die nationalen Bilanzen durchschlagen. Also Eurobonds, was Deutschland seit jeher ablehnt, aber in der Pandemie ermöglichte. Und dazwischen einige schwankende Staaten: Frankreich etwa und auch Österreich.
Entweder europäische Schulden machen oder russische Vermögen einsetzen – wie sollten die Chefs diesen Grundsatzkonflikt lösen? António Costa, der Präsident des Europäischen Rats, konnte es auch nicht sagen, bevor die Auseinandersetzung hinter verschlossenen Türen begann. Nur so viel versprach der Portugiese: „Ich kann garantieren, dass wir hier nicht ohne eine abschließende Entscheidung weggehen werden, entweder heute oder morgen.“ Oder übermorgen. Drei Hemden sollten sie mitbringen, hatte er den Herren in der Runde vorher geraten. Drei Hemden für drei Tage.
Die beiden Kontrahenten waren Merz und De Wever, und es schien, als könne nur einer von beiden als Sieger vom Platz gehen. Eine Woche zuvor hatten sie sich zu einem Abendessen in Brüssel getroffen. Als „Eisbrecher“ wurde das anschließend beschrieben. Sicher ist: Das Eis zwischen den beiden Männern war sehr dick geworden, seit sie sich Ende August in Berlin getroffen hatten. De Wever legte das Zerwürfnis in seinem Parlament in entwaffnender Offenheit dar.
Seine „große Frustration“, so leitete er das ein, habe mit der „180-Grad-Wende“ in Berlin begonnen. Unter Kanzler Olaf Scholz sei Deutschland der größte Gegner einer Verwendung der russischen Vermögen gewesen. „Gefährlich und illegal“, habe Scholz das genannt. Dann sei Merz gekommen und habe es ganz anders gesehen. Er habe den Kanzler bei jenem Besuch im August gewarnt, sagte De Wever. „Das birgt enorme Risiken und Fallstricke, die Sie als neuer Bundeskanzler meiner Meinung nach noch nicht zu 100 Prozent wahrnehmen.“ Man müsse darüber sprechen. „Lassen Sie uns also vor allem diskret vorgehen.“ So sei es aber nicht gekommen: „Ich muss feststellen, dass dies völlig ignoriert wurde und man öffentlich Druck aufgebaut hat.“
Merz führt, spricht sich aber mit niemandem ab
Damit spielte der belgische Ministerpräsident auf den Namensbeitrag an, den Merz Ende September in der „Financial Times“ veröffentlichte. Noch bevor die Kommission ein erstes Konzeptpapier dazu verteilen konnte, stellte sich Merz mit aller Macht seines Amtes hinter ein Reparationsdarlehen.
Ein typischer Zug des Kanzlers: Er führt, aber er spricht sich mit niemandem ab. Seinerzeit wollte er vor allem Emmanuel Macron unter Druck setzen. Das gelang auch, der französische Präsident unterstützte den Vorschlag, als der Europäische Rat ein paar Tage später in Kopenhagen erstmals darüber beriet. De Wever aber fühlte sich in die Ecke gedrängt und übergangen. Drei Wochen später durchkreuzte er eine Einigung bei der nächsten Zusammenkunft in Brüssel und setzte durch: Wenn man sich im Dezember wiedersehe, müssten mehrere Optionen auf dem Tisch liegen.
So kam es dann auch: gemeinsame Schulden aufnehmen oder russische Vermögen einsetzen – das war die Wahl, vor die Ursula von der Leyen die Staaten stellte. Allerdings wirkte das wie eine Scheinwahl. Denn für ein Reparationsdarlehen reichte die qualifizierte Mehrheit aus, während für gemeinsame Schulden ein einstimmiger Beschluss nötig war. Und den blockierte Ungarn von Anfang an. Sie sehe kein Szenario, „in dem allein die europäischen Steuerzahler die Rechnung bezahlen werden“, sagte die Kommissionspräsidentin Ende November im EU-Parlament.
De Wever wollte sich damit nicht abfinden. Er schrieb einen wütenden Brief und suchte Verbündete, um sich aus seiner Isolation zu befreien. Vor einer Woche ein erster Erfolg: Gemeinsam forderten Belgien, Italien, Bulgarien und Malta die Kommission auf, weiter nach einer Schulden-Option zu suchen. Was sie damit meinten, legten sie am Dienstagabend in einer Sitzung der EU-Botschafter dar: Die Kommission solle eine „kreative Lösung“ finden, um den Einstimmigkeitszwang zu beseitigen. Wie? Indem sie den Notstandsartikel in den EU-Verträgen, Nummer 122, einsetzt. Der erlaubt in außergewöhnlichen Fällen Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit. So sollte die Verordnung zum Mehrjährigen Finanzrahmen geändert werden: damit Schulden nicht nur, wie jetzt zugunsten von Mitgliedstaaten gemacht werden können, sondern auch zugunsten der Ukraine.
Das wies der Juristische Dienst des Rates noch in derselben Sitzung als unmöglich zurück, wie Diplomaten übereinstimmend berichteten. Zwar hatte man dasselbe Instrument gerade erst eingesetzt, um die russischen Zentralbankvermögen mit qualifizierter Mehrheit dauerhaft zu sperren – gegen den Widerstand Ungarns und der Slowakei. Doch seien beiden Ländern damit keine finanziellen Lasten auferlegt worden, so das Argument der Ratsjuristen, während ein Beschluss über neue Schulden beide Länder gegen ihren Willen binden würde. Natürlich würden die dagegen beim Europäischen Gerichtshof klagen und hätten hohe Aussicht, zu gewinnen. Auch die Kommission sah das so. Ein „Nonstarter“ sei das, hieß es hinterher.
Als De Wever am Donnerstagmorgen in seinem Parlament danach gefragt wurde, hatte er das schon verdaut. Der Notstandsartikel sei eine „Überdehnung“ und juristisch heikel, gestand er ein. Wenn der EuGH dessen Anwendung annulliere, geriete man in ein „Universum von Problemen“. Trotzdem beharrte De Wever darauf, dass es eine Alternative zum Reparationsdarlehen geben müsse. Bestimmte Länder, wie eben Italien, „könnten zu Option B wechseln, wenn Option A zu kompliziert wäre“. Wie diese Option aussehen könnte, sagte er nicht.
Auch De Wever sagt: Scheitern ist keine Option
Eines gab aber auch der belgische Regierungschef zu: Scheitern ist keine Lösung. Wenn man die Ukraine nicht weiter finanziere, breche sie zusammen. „Das ist der ultimative geopolitische Niedergang für Europa, den wir noch Jahrzehnte lang spüren werden“, sagte er. „Von da an spielen wir keine Rolle mehr.“ Es wäre katastrophal, „wenn wir wenn wir in völligem Chaos auseinandergehen“.
Darin konnte man eine Öffnung sehen, einen Schritt herunter vom Baum, auf den De Wever geklettert war. Ja, er deutete sogar an, dass Belgien bei der gemeinsamen Übernahme von Rechtsrisiken des Reparationsdarlehens „ein klein wenig flexibel sein könne“. In den vorangegangenen Verhandlungen hatte das Land darauf gepocht, dass die anderen Staaten „unbegrenzte Garantien“ abgeben, in Zeit und Höhe, falls die Vermögen an Russland zurückgezahlt werden müssen. Auch das war für die anderen ein „Nonstarter“: Niemand kann für eine Milliardensumme in unbegrenzter Höhe bürgen. Selbst wenn die EU-Kommission Schulden aufnähme, müsste sie sich an die gesetzlich festgelegte Ausgabenobergrenze halten.
In der deutschen Delegation wurden diese Aussagen genau verfolgt. Sie deckten sich mit Signalen, die De Wever dann auch intern gab. „Es gibt Bewegung“, hieß es am Mittag aus Kreisen der Bundesregierung. „Es geht in die richtige Richtung, wir sind aber noch nicht da.“ De Wever, so die Analyse, wolle weiter eine Option B, werde sich einer Option A aber nicht versperren, wenn diese von genügend Ländern unterstützt werde. Als positives Zeichen wurde auch gewertet, dass die Staats- und Regierungschefs ihren Rat dann doch nicht mit der Finanzierung der Ukraine begannen, sondern mit einer Debatte über die EU-Erweiterung. Das bedeutete mehr Zeit, um im Hintergrund einen Deal zu schmieden.
Am Rande der Tagung traf De Wever auch Wolodymyr Selenskyj, den ukrainischen Präsidenten. Der war persönlich gekommen, um für ein Reparationsdarlehen und damit das finanzielle Überleben seines Landes zu werben. Die belgischen Bedenken kommentierte er anschließend so: „Man kann rechtliche Schritte vor Gericht fürchten. Aber das ist nicht annähernd so beängstigend, wie wenn Russland an den eigenen Grenzen steht.“