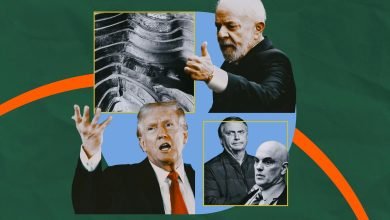Stadion, Sportfeld, Victory Park: 100 Jahre Frankfurter Waldstadion | ABC-Z

Frankfurter Fußballer sind noch nie im eigenen Stadion deutscher Meister geworden. Einmal wäre es beinahe geglückt. Die Frankfurter standen im Endspiel. Aber nicht die Kicker von Eintracht Frankfurt, sondern die des FSV Frankfurt. Nach der regulären Spielzeit stand es 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg. Die Entscheidung erzwang in der 108. Spielminute der Nürnberger Ludwig Wieder durch einen scharf in die rechte untere Ecke geschossenen Ball. Das war am 7. Juni 1925. Es war das erste große Fußballmatch im neuen Waldstadion, das gerade einmal einen halben Monat vorher am 21. Mai 1925 eröffnet worden war. Die Arena bestand an diesem Tag ihre Bewährungsprobe.
Einmal ist Eintracht Frankfurt dann doch deutscher Fußballmeister geworden. Mit einem schwer erkämpften Sieg von 3:2 im ausverkauften Waldstadion gelangte die Eintracht ins Endspiel und besiegte in einem Traumfinale am 28. Juni 1959 die Offenbacher Kickers mit 5:3 in der Verlängerung. Aber nicht im Waldstadion, sondern im Olympiastadion in Berlin. Alte Eintracht-Fans können die damalige Siegermannschaft noch im Schlaf herunterbeten: Pfaff, Kreß, Sztani . . . Natürlich wäre es den Frankfurtern und wohl auch den Gegnern aus der Nachbarstadt lieber gewesen, dieses Herzschlagfinale im Waldstadion erleben zu können. Doch die Regeln des Deutschen Fußballbundes sahen die deutsche Hauptstadt als Austragungsort vor.
Das Waldstadion, dessen 100. Geburtstag am 21. Mai ansteht, hat eine komplizierte Zangengeburt erlebt. In der Entscheidung vom 25. August 1921 hieß es: „Der Magistrat beschließt grundsätzlich die Herstellung einer Sportanlage auf dem Gelände der ehemaligen Militärschießstände im Stadtwald.“ Die Stadtverordneten genehmigten im Dezember jenes Jahres 800.000 Mark für den Bau. Doch die Inflation ließ den Wert dieser Summe schnell in Richtung null schrumpfen, weshalb es am 6. November 1922 zu einem Baustopp kam.
Stadion markiert Beginn des „Neuen Frankfurts“
Die ganze Entwicklung haben Thomas Bauer und Jörg Hahn, viele Jahre Leiter der Sportredaktion der F.A.Z., in ihrem zum Jubiläum erschienenen Buch „100 Jahre Sportpark. Das Waldstadion als Bühne für Frankfurt und die Welt“ in allen Details beschrieben. Die Stadt hielt trotz ihrer äußerst schwierigen finanziellen Lage an dem Vorhaben fest und führte die Arbeiten am Sportpark im Stadtwald von Ende Januar 1923 an als Notstandsarbeiten fort. Im August 1923 genehmigten die Stadtverordneten die inflationsgetrieben schwindelerregende Summe von 1,8 Milliarden Mark für den Weiterbau.
Zudem sicherte die Regierung in Berlin den Frankfurtern Gelder aus der Erwerbslosenfürsorge zu, die den Arbeiten an der Kampfbahn zugutekamen. Im November 1924 bewilligte der Magistrat weitere 1,24 Millionen der neuen Reichsmark. Weil auch das nicht reichte, stockte die Stadt im Frühjahr 1925 das Budget um eine knappe Million Mark auf. Damit war die Fertigstellung des Stadions endgültig gesichert. Das Revisionsamt errechnete 1927 eine inflationsbereinigte Gesamtsumme von 4,5 Millionen Reichsmark, worin auch die Kosten für das Licht- und Luftbad und die Wintersporthalle im Stadtwald einberechnet waren.
Der Bau des Stadions im Stadtwald bildete den Auftakt einer unvergleichlich schnellen und erfolgreichen Modernisierung Frankfurts, in die Wege geleitet durch Oberbürgermeister Ludwig Landmann. In die Stadtgeschichte ist die Epoche eingegangen als „Das Neue Frankfurt“. Im Zuge dieses Reformprogramms wurde unter anderem der Wohnungsbau mit den May-Siedlungen entscheidend vorangebracht, entstand die Großmarkthalle, wurde mit dem Ausbau des Flughafens am Rebstock die Grundlage gelegt für den heutigen internationalen Flughafen, erhielt die Messe neue Impulse.
Sport zur Stärkung der Demokratie
Auf dem Gelände im Stadtwald, auf dem die Stadt damals nicht nur das Stadion, sondern auch das Stadionbad, eine Radrennbahn, eine Wintersporthalle sowie Tennisplätze bauen ließ, hatten vor und während des Ersten Weltkriegs Soldaten auf Schießständen das Treffen geübt. Nach der Niederlage des Deutschen Reiches 1918 musste das Militär die Anlage aber aufgeben, und das Areal fiel an die Stadt.
Bei der Eröffnung des Stadions vor 100 Jahren wies Oberbürgermeister Landmann explizit darauf hin, dass im Stadtwald an den Schießständen eine Erziehung zum mörderischen Kampf praktiziert worden sei. Nun aber wolle man hier eine Erziehung zum Wettstreit, eine Schulung des Körpers, des Willens und des Geistes betreiben. Durch fairen sportlichen Wettkampf, so der Gedanke, sollten die Sportler sich auch in die neue Demokratie einüben.
23 Jahre und ein Weltkrieg später griff der damalige Oberbürgermeister Walter Kolb bei der Eröffnung des Frankfurter Turnfestes 1948 den Gedanken seines Vorgängers Landmann wieder auf. Sport sei unverzichtbar für die neue Demokratie, sagte Kolb und sprach die Hoffnung aus, dass nach dem nationalsozialistischen Missbrauch des Sports als Wehrertüchtigung nun auf den Sportplätzen der Stadt und des Landes die Spielregeln der Demokratie eingeübt würden.

Die Nazis haben nicht nur den Sport, sondern auch das Waldstadion missbraucht. Bis zu ihrer Machtübernahme 1933 hatten im Stadion und in den anderen Einrichtungen ausschließlich sportliche Aktivitäten stattgefunden. Das Stadion, aber auch die Radrennbahn oder die Wintersporthalle glänzten als Bühnen großer Sportereignisse. Aber sie waren auch der Trainingsort für Abertausende Frankfurter, die zu Übungskursen ins Stadion oder in die Winterhalle kamen. Politische Veranstaltungen dagegen waren tabu.
Das Waldstadion im Zweiten Weltkrieg
Nach der braunen Machtübernahme erlaubte der Magistrat auf Druck der Nationalsozialisten Aufmärsche und politische Versammlungen im Stadion. So nahmen am 11. Juni 1933 etwa 9000 SA-Männer in Reih und Glied Aufstellung vor Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS. Sogar den Namen des Stadions änderten die neuen Herren. Denn der NS-Oberbürgermeister Friedrich Krebs störte sich an dem griechischen Ursprung des Wortes „Stadion“, von 1935 an hieß die Arena deshalb gut deutsch „Sportfeld Frankfurt“.

Mit Beginn des Krieges wurde der Sportbetrieb im Stadtwald allerdings weitgehend eingestellt. Als am 29. März 1945 amerikanische Truppen Frankfurt besetzten, fanden sie ein verwüstetes und geplündertes Sportfeld vor. Die Army beschlagnahmte das Areal und benannte es in „Victory Park“ um. Im „Victory Stadium“ fand American Football statt, im „Victory Pool“, dem Stadionbad also, veranstalteten die Amerikaner Schwimmwettkämpfe.
Im Juni 1946 durften zum ersten Mal wieder deutsche Sportler das Stadion nutzen. 40.000 Zuschauer kamen zum „Tag der Eintracht“, veranstaltet von der Frankfurter Sportgemeinde Eintracht, um den Wettkämpfen von Ringern, Judokas, Radrennfahrern, Turnern, Leichtathleten und natürlich auch Fußballern beizuwohnen. Am 1. Dezember 1946 spielte endlich wieder die Fußballmannschaft der Eintracht im Stadion, gegen den 1. FC Nürnberg erreichte sie ein 1:1. Schritt für Schritt wurde der Stadionbetreiber, die Stadion GmbH, wieder Herr im eigenen Haus. Zuerst gaben die Amerikaner ihr im Herbst 1948 die Radrennbahn und die Tennisanlage zurück, ein Jahr später die Wintersporthalle und schließlich im Sommer 1950 das Stadion.
Frankfurt bleibt eine Sportstadt
Schon 1925 hatte der Magistrat unter Ludwig Landmann beschlossen, den Betrieb der Sportstätten nicht einem städtischen Amt zu übertragen, sondern einer „von bürokratischen Hemmungen“ unbelasteten, privatwirtschaftlich arbeitenden Gesellschaft. Allerdings befand sich diese „Stadion-Betriebsgesellschaft“ ganz im Besitz der Stadt Frankfurt. Diese Organisationsform hat sich bis heute bewährt, auch wenn sich die heute „Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklung“ genannte Betriebsgesellschaft den Betrieb der Arena mit der „Eintracht Frankfurt Stadion GmbH“ teilt.

Mit dem Bau des Stadions im Stadtwald und den anderen Sportstätten war Frankfurt vor 100 Jahren zur führenden Sportstadt in Deutschland aufgestiegen. Diesen Rang drohte sie nach dem Zweiten Weltkrieg zu verlieren, weil Städte wie Stuttgart oder Hamburg größere Arenen hatten errichten lassen. Für sportliche Spitzenereignisse war das Stadion im Stadtwald jetzt zu klein. Die Stadt Frankfurt reagierte mit einer Vergrößerung der Arena auf 87.000 Plätze. Kaum ein Stein blieb damals bei dieser Radikalkur auf dem anderen. Am 14. Mai 1955 übergaben der hessische Ministerpräsident Zinn und Oberbürgermeister Kolb das runderneuerte Stadion den Sportlern.

Danach ließ der Deutsche Fußballbund (DFB) wieder Länderspiele im Waldstadion austragen. 80.000 Besucher sahen am 21. November 1956 bei klirrender Kälte das Spiel des Weltmeisters Deutschland gegen die Schweiz – die Schweizer gewannen 3:1. Schließlich kam das Jahr 1959, das die Herzen der Eintracht-Fans noch heute höherschlagen lässt. Die Eintracht-Kicker kamen in die Endrunde. Doch, wie anfangs erwähnt, gewannen sie den Titel gegen Offenbach nicht im eigenen Stadion, sondern in Berlin.
Ein Ort mit vielen Erinnerungen
Die nächste Frischzellenkur erlebte das Waldstadion vor der Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Städte, welche mit ihrer Arena als Austragungsort teilnehmen wollten, mussten aber 20.000 überdachte Plätze vorweisen, weshalb Frankfurt das Waldstadion für 28,5 Millionen Mark umbauen ließ und sich so nicht nur die Teilhabe an der Weltmeisterschaft, sondern auch die Eröffnungsfeier sicherte. Dieser 13. Juni 1974 gilt vielen bis heute als größter Tag in der Geschichte des Waldstadions.
62.000 Zuschauer im Stadion und etwa 600 Millionen Fernsehzuschauer weltweit sahen das Eröffnungsspiel Brasilien gegen Jugoslawien, das torlos endete. Während dieses Turniers fand im Waldstadion die legendäre „Wasserschlacht von Frankfurt“ statt: Sintflutartige Regenfälle hatten das Spielfeld, auf dem Deutschland gegen Polen spielte, in einen Morast verwandelt. Deutschland gewann mit 1:0. Und das Stadion bekam danach eine moderne Drainage und eine Rasenheizung.
Wiewohl das Waldstadion in erster Linie eine Fußballarena ist, in der Eintracht Frankfurt seine Heimspiele austrägt, wird es seit Ende der Achtzigerjahre auch für Großkonzerte genutzt. Springsteen, die Rolling Stones oder Tina Turner sind schon aufgetreten. Weil die Stadion GmbH Defizite erwirtschaftete, musste sie über den Fußball hinaus andere Veranstaltungen akquirieren. So lud die Evangelische Kirche 1983 ins Stadion zu ihrem Kirchentag ein, und die Commerzbank feierte 1995 dort ihren 125. Geburtstag.
Anhänger der Eintracht halten bis heute den 21. Mai 1980 als den bedeutendsten Tag im Waldstadion in Erinnerung. Damals wurde ihre Mannschaft UEFA-Pokalsieger. Trainer war Friedel Rausch. Er brachte in der Schlussviertelstunde einen gerade einmal 19 Jahre alten Spieler namens Fred Schaub aufs Spielfeld. Der schoss das Siegtor. Im Waldstadion, das zu seinem 100. Geburtstag auch diese Erinnerung mit sich trägt.
100 Jahre Waldstadion: Eine Chronik
25. August 1921
Die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung beschließt den Bau einer neuen Sportstätte: ein Stadion mit 37.000 Zuschauerplätzen, ein Turn- und Festplatz, ein Radstadion sowie ein Schwimmbad.
Die Entwürfe stammen von Gartenbaudirektor Max Bromme für die Gesamtanlage und von Stadtbaurat Gustav Schaumann für das Tribünengebäude. Die Gesamtkosten betragen 3,7 Millionen Mark.
21. Mai 1925
Das fertiggestellte Waldstadion wird offiziell eröffnet.
24. bis 28. Juli 1925
3000 Sportler aus elf Ländern nehmen an der 1. Internationalen Arbeiterolympiade teil.
23. September 1933
Zum Gauparteitag der NSDAP in Hessen-Nassau versammeln sich zwischen 150.000 und 200.000 NSDAP-Mitglieder im Stadion.
Januar 1935
Oberbürgermeister Friedrich Krebs stört der griechische Ursprung des Wortes „Stadion“ und er verfügt im Januar 1935 die Umbenennung des Stadions in „Sportfeld Frankfurt“.
12. August 1939
Rudolf Harbig stellt mit einer Zeit von 46,0 Sekunden einen neuen 400-Meter-Weltrekord im „Sportfeld Frankfurt“ auf.
1943/44
Die Frankfurter Innenstadt versinkt bei schweren Luftangriffen in Schutt und Asche. Das außerhalb gelegene „Sportfeld“ bleibt von den Bombenteppichen weitgehend verschont.
1. Mai 1945
Die amerikanische Militärverwaltung beschlagnahmt das Areal im Stadtwald, benennt es um in Victory Park und lässt nur selten Sportveranstaltungen zu.
15. Juni 1950
Die amerikanische Besatzungsmacht gibt das Waldstadion endgültig wieder an Frankfurt.
17. Mai 1953
Zum Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Kaiserslautern werden fast 70.000 Karten für die Arena mit ihren 55.000 Plätzen verkauft. Rund 200 Stadionbesucher werden im Gedränge verletzt.
14. Mai 1955
Das umgebaute und erweiterte Waldstadions wird eröffnet. Es soll Platz für 87.200 Zuschauer bieten, davon 16.000 Sitzplätze und 71.200 Stehplätze.
23. Mai 1959
Im Spiel der Eintracht Frankfurt gegen den FK Pirmasens wir mit 81.000 Besucher ein bis heute gültiger Zuschauerrekord aufgestellt.
5. Juni 1963
Pelé ist zu Gast zum Freundschaftsspiel mit dem FC Santos.
10. September 1966
Kampf um die Schwergewichts-Weltmeisterschaft im Boxen zwischen Muhammad Ali und Karl Mildenberger.
27. März 1974
Rechtzeitig zur Fußballweltmeisterschaft 1974 wird das erneut umgebaute Waldstadion eröffnet. Es bietet rund 60.000 Zuschauern Platz.
3. Juli 1974
Aufgrund starker Regenfälle wird das Zwischenrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Polen auf einem nahezu unbespielbaren Platz ausgetragen und geht als “Wasserschlacht von Frankfurt” in die Fußballgeschichte ein. 1978 wird eine Drainage und eine Rasenheizung installiert.
26. Mai 1990
Eines der ganz großen Highlights in der Konzertgeschichte des Waldstadions: Die Rollings Stones gastieren mit der Urban Jungle Tour im Waldstadon. Schon vor dem Umbau zur Arena, die eine ganz andere Dimension der Konzerterlebnisse ermöglicht, war Frankfurt mit dieser Freilichtbühne eines beliebter Austragungsort.
23. Mai 2002
Das erste Endspiel um den neugeschaffenen Fußball-Europapokal der Frauen findet statt.
15. Juni 2005
Nach einem erneuten Umbau zwischen 2002 und 2005, der etwa 126 Millionen Euro kostet, wird das Waldstadion mit dem Spiel Deutschland gegen Australien beim Konföderationen-Pokal wiedereröffnet. Die Summe umfasst die umfassende Modernisierung und den Umbau zu einem reinen Fußballstadion. Die alte Laufbahn ist entfallen, die Zuschauer rücken dadurch ein ganzes Stück näher ans Spielfeld. In die Haupttribüne werden 76 Logen, 2200 lederne Business-Seats und große VIP-Räume eingebaut. Das Stadion hat ein bewegliches Zeltdach. Mit einem Fassungsvermögen von rund 60.000 Zuschauern ist es das siebtgrößte Fußballstadion in Deutschland.
Zur Anlage gehören weitere Sportstätten: zusätzliche Fußballfelder, das Stadionbad, eine Beachvolleyball-Anlage und eine Turnhalle.
1. Juli 2005
Für zunächst 10 Jahre wird das Waldstadion in Commerzbank-Arena umbenannt. Die Commerzbank zahlt für dieses Recht rund 30 Millionen Euro an die städtische Betreibergesellschaft. Die Commerzbank lässt den Sponsoringvertrag zum 30. Juni 2020 nach 15 Jahren auslaufen.
17. Juli 2011
Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen findet im Waldstadion statt.
1. Juli 2020
Neuer Namenssponsor wird zum 1. Juli 2020 die Deutsche Bank, mit der ein Vertrag bis zum 30. Juni 2027 mit Option auf Verlängerung geschlossen wird. Die Eintracht Frankfurt Fußball AG wird Hauptmieter des Stadions, das nun Deutsche Bank Park heißt.