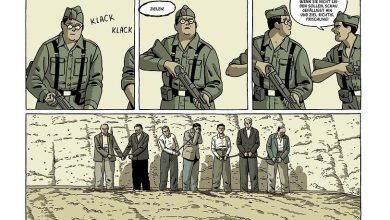Tanzperformance auf Europatour: Die lange Nacht des Überlebens | ABC-Z

So eine Enttäuschung. So eine große, wunderschöne Enttäuschung: Marlene Monteiros Freitas’ alptraumhafte Produktion „Nôt“ hat bei ihrer Uraufführung im Ehrenhof des Papspalasts von Avignon Anfang Juli das Spektakelversprechen der monumentalen gotischen Kulisse gekonnt ins Leere laufen lassen. Sie hat alle Pathosgesten vermieden, zu denen die mittelalterliche Prunkarchitektur einlädt, hat jede Sinnerwartung chillig ausgetänzelt und die Wahrnehmung des Bühnengeschehens komplett fragwürdig gemacht.
Nun kommt die Produktion nach Deutschland, um dann über Genf, Lissabon und Athen weiter durch Europa zu touren. Mitte August ist sie in Berlin zu sehen, wo die kapverdische Choreografin ab 2026 zum neuen künstlerischen Leitungsteam der Volksbühne gehören wird. Schon am Mittwoch aber feiert „Nôt“ in Hamburg Deutschlandpremiere. Als Eröffnungsstück des Sommerfests soll die Performance auf Kampnagel beweisen, dass sie sich auch in vergleichweise neutralen Theaterräumen behaupten kann. Keine Ahnung, ob das funktioniert.
Freitas nimmt mit dem Stück Bezug auf „1001 Nacht“. Tatsächlich heißt „Nôt“ im Kreolischen der nördlichen Kapverden einfach nur Nacht. Ein Nebensinn ist auch dem Kreolistik-Prof Jürgen Lang nicht bekannt, teilt er der taz auf Nachfrage, und sicher keine verneinende Bedeutung. Und doch wirkt diese generisch schwer fassbare Arbeit, wie eine große lustvolle Verweigerung: „Nôt what you expect“ hat die Kritikerin Camille Doucet das im Theaterblog „Pleins Feux“ in einem treffenden Wortspiel zusammengefasst.
Fluten von Bildern und Szenen in rascher Folge
Einen erzählerischen Bogen, den doch der Bezug auf die arabischen Märchen zu verheißen scheint, gibt es nicht. Was es gibt sind Fluten von Bildern und Szenen in rascher Folge. Manchmal ist man froh, hinten zu setzen, wo Freitas und Francisco Rolo am Lichtsteuerpult live die Spots und die Geräusch- und Soundkulisse ans Bühnengeschehen anpassen.
Denn erstens ist es toll, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich von dem Rhythmus ihres eigenen Stücks mitreißen lassen, es hinten gleichsam für sich am Ton- und Technikplatz tanzen. Andererseits beschwört halt eine bewusst quälend lang ausgespielte Sequenz mit einem Nachttopf, der erst gefüllt und dann mit den Zuschauer*innen in den vorderen Reihen geteilt wird, mit großem Nachdruck den koprophagen Fäkalhumor der Märchensammlung.
Im Kopf, als Erinnerung, lassen sich manche der Figuren, die auf der Bühne Körper gewinnen, der literarischen Vorlage annähern, die meisten aber nicht mit ihr identifizieren: Auf der von weißen Gitterwänden gegliederten Bühne begleiten drei Männer, in drei stramm mit gebleichten Laken bezogenen Betten liegend auf ihren vorgeschnallten Snare-Drums Igor Strawinskys drängende „Noces“-Suite, die metallisch vom Band ertönt. Aber wären das nun die Wiedergänger der drei Bettelmönche?
Mit reduzierten Salsaschritten
Und: Sicher gibt es Kannibalismus in „1001 Nacht“ – aber doch keine Geschichte, in der mehrere mit starr lächelnden Puppengesichtern maskierte Personen einander wechselseitig das Fleisch von den Rippen schneiden, um es zu verpeisen? Auch erlaubt die in den Programmen als Tanztheater rubrizierte Bühnenbespielung den acht Akteur*innen meist nur robotisch-eckige Trippelbewegungen.
Im herkömmlichen Sinne tanzt mit am meisten Joãozinho Costa: Noch bevor es richtig losgegangen zu sein scheint, schwingt er sich, im weißen Plissee-Röckchen, das er ab und an neckisch lüftet, mit reduzierten Salsaschritten vorne links auf der Bühne zu einer geloopten Musiksequenz ein.
Das hat etwas raubtierhaft-lauerndes, das zugleich majestätisch-selbstbewusst wirkt: Man wird in ihm die aus Kränkung gespeiste Grausamkeit des Sultan Shahriyar verkörpert sehen. so wird man in Mariana Tembe die Heldin erkennen: Indem sie die Bühne entschlossen durchquert nimmt die beinlose Tänzerin den Raum in Besitz. Sie macht sich selbst, macht ihren Körper dank seiner Behinderung zum Ausdruck eines unbezwingbaren Überlebenswillens.
Die Kritik aufs Schönste gespalten
Er wirkt, als könnte dem nichts etwas anhaben, noch nicht einmal der geifernde Hass auf Menschen mit Behinderung, in den Figaro-Rezensent Anthony Palou den Frust über sein offenkundiges, eigenes Unverständnis angesichts dieser Performance entladen hat. Tatsächlich hat die Produktion in Frankreich sowohl das Publikum, als auch die Kritik aufs Schönste gespalten, bis in die Redaktionen hinein: Nicht nur bei der Premiere treffen Buhs auf frenetischen Beifall.
Und während Marie Sorbier von Radio France sich in einem Spektakel ohne jede schöpferische gelangweilt hat, hat ihr Kollege Siegfried Forster vom gleichen Sender zugesehen, wie sich eine „fulimante Performance“ im Papstpalast „mit Kraft und Wahnsinn“ entfaltet habe. Mit ihr habe sich Freitas „ein für alle Mal in die Geschichte des Tanz’ und des Theaters eingeschrieben“.
Manche schreiben Kunst die Aufgabe zu Einheit und Harmonie zu stiften. Aber das Gegenteil ist ja wahr. Wirklich gut ist sie erst, wenn sie diese Zwangsversöhnungen aufbricht, und das heißt eben auch, dass sie den Lack der Zivilisation von als Intellektuellen getarnten Unmenschen absprengen muss, und eine allgemeine Uneinigkeit herstellt. Über die lässt sich nämlich denken, reden, auch streiten. Und das sogar im Frieden. Das sollte auch in Deutschland möglich sein.