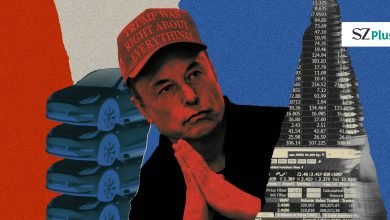Kultur im Koalitionsvertrag: Phrasen statt Kreativität | ABC-Z

Wer stillt denn unsere Bedürfnisse? Wer sorgt für unser Wohlbefinden, für Inspiration und Irritation, ohne die es keinen Fortschritt gibt? Wer hält unsere Fähigkeit wach, sich ein besseres Leben vorzustellen? Ist es nicht der Künstler, die Künstlerin? Die Künstler, die das Leben reflektieren, kritisch und gesellschaftsrelevant.
Unser Land ist ein Kulturstaat. Die Künstler, die mit ihrer Einbildungskraft oft unter schwierigen Bedingungen ihre Phantasie einsetzen, um Werke hervorzubringen, die auf Leinwänden, Bühnen und Buchseiten erscheinen und hernach – in die Städte und auf das Land befördert, denn es soll überall gleichwertige Lebensverhältnisse geben – in den Galerien, den Kinos und den Verlagen anlangen, die daraus Nahrungsmittel für Arm und Reich machen. Sind es nicht wiederum die Künstler, die für unseren Kulturaustausch, für die Kulturdiplomatie und den Kulturtourismus ihren Werken Bedeutsamkeit angedeihen lassen in den Ateliers, Schreibstuben und Probebühnen?
Bis hierher war alles ein Zitat. Genauer: zwei Zitate. Wir haben Vokabeln und Wendungen aus dem Abschnitt des Koalitionsvertrags zwischen Union und SPD, der die Kultur betrifft, in das literarische Urbild aller Phrasendrescherei hineinkopiert, die Rede des Präfekturrats Lieuvain aus Gustave Flauberts „Emma Bovary“. Gehalten wird sie dort auf der berühmten Landwirtschaftsausstellung („ces fameux Comices“). Wir haben nur das Wort „agriculteur“ durch „Künstler“ ersetzt sowie von Mehl und Kühen auf Bilder und Bühnenwerke umgeschrieben. Die rhetorischen Fragezeichen des Concellier Lieuvain (deutsch etwa: „Leerort“) fehlen im Koalitionsvertrag, alle anderen Phrasen finden sich dort.
Kunst, die sie nicht meinen können
Welche Erfahrungen mit Kunstwerken haben Leute, die so formulieren? Sie ordnen ihnen die Beförderung des Fortschritts zu, als sei Fortschritt – wohin? – der letzte Zweck allen menschlichen Tuns. Die Kunst der Vergangenheit können sie damit nicht meinen, die oft in Zeiten entstand, in denen das Konzept des Fortschritts gar nicht zur Verfügung stand. Bilder, Stücke, Romane lassen sich auch nicht entlang einer Fortschrittslinie anordnen. Shakespeare wurde nicht von Racine „überwunden“, Lessing hat Racine nicht ersetzt. Von Künstlern, denen Fortschritt, Urbanität oder die moderne, oft bürgerlich genannte Gesellschaft suspekt sind, haben wir dabei noch gar nicht gesprochen.
Nun wird eingewendet werden, die Kulturpolitik habe sich inhaltlich gar nicht mit der Kunst zu befassen. Denn die sei ja frei. Ob das die Folgerung erlaubt, Kulturpolitik könne auch ohne Verständnis dessen, was sie fördert, betrieben und Leuten überlassen werden, die von Kunst so viel verstehen wie Andreas Scheuer von der Maut, sich vor allem mit Popmusik und Clubs auskennen oder mit Stadtteilfesten, ist zweifelhaft. Sätze im Koalitionsvertrag wie der, künstliche Intelligenz (KI) steigere die Möglichkeiten menschlicher Kreativität enorm, sind empiriefrei gebildet und zwar sowohl, was die derzeitige Wirklichkeit der KI angeht, wie die Art bisheriger Kreativität in den Künsten.
Die gähnende Langeweile, die von den Abschnitten über Kultur im Koalitionsvertrag ausgeht, rührt von dieser Ahnungslosigkeit. Es werden vor allem Werte bekräftigt. Alles für gut Befundene wird fortgeführt, vom „Denkmalschutzsonderprogramm“ über die „Gedenkstättenlandschaft“ und die Künstlersozialkasse bis zur Digitalisierung des Bundesarchivs. Wer wollte dagegen sein? Außer dem Vorschlag, die Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken finanziell zu ermöglichen, findet sich kein einziger Punkt enormer oder auch nur überraschender kulturpolitischer Kreativität. Worin man sich nicht sicher oder worüber man uneins ist, wird „geprüft“. Als hätten Union und SPD nicht jahrelang Zeit gehabt, Entschiedenheit in offenen Fragen (Abgabe für Online-Plattformen, strukturelle Verlagsförderung, Fortführung des Kultur-Passes) herbeizuführen. Mal sehen, ob „wird geprüft“ nur ein Synonym für „wird vertagt“ ist.
Was nicht geprüft wird, ist das politische Faible für Subventionen. Kunst und Kultur sind frei, aber ökonomisch offenbar nicht selbsttragend. Deshalb wird ihre „lebendige Infrastruktur“ – das Wort der Stunde – zu einem Fall von „Daseinsvorsorge“ erklärt, ein Begriff, der einst für die öffentliche Bereitstellung von Strom, Wasser und Verkehrsmitteln reserviert war. Ist die Stelle des Staatsministers für Kultur also tatsächlich die eines Kulturwirtschaftsministers? Dann wäre es zum Horizont der Landwirtschaftsausstellung wirklich nicht weit.