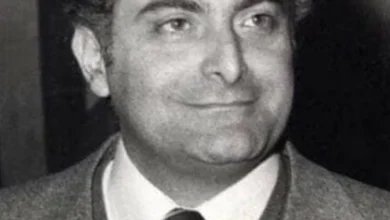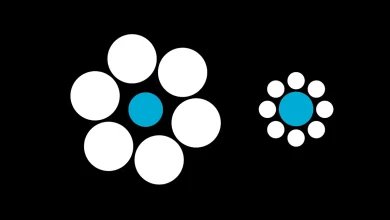Münzenberg: Geschichte der Burg in der Wetterau muss neu geschrieben werden | ABC-Z

Die Flammen müssen weithin sichtbar sein. Das erklärt sich nicht nur mit der erhabenen Lage von Burg Münzenberg als Zeichen der Macht des Adelsgeschlechts der Herren von Münzenberg. Die Flammen nähren sich zudem aus Hölzern des Fachwerkbaus, züngelten meterhoch und vernichten das Gebäude. So ungefähr muss es gewesen sein in jenen Jahren in der Mitte des 13. Jahrhunderts, welche in der Geschichtsschreibung als Interregnum bekannt sind. Der Papst hatte gerade den Stauferkaiser Friedrich II. abgesetzt, dessen Nachfolger war noch nicht gewählt. Womöglich folgte dieser Brand aus einem Angriff auf die Burg. Auf jeden Fall spielt er eine wichtige Rolle in der Neubewertung einer zentralen Frage für Archäologen.
Diese Frage lautet: Entstand die äußere Ringmauer der Münzenburg erst als Reaktion auf die Zerstörung, während die innere Mauer schon vorher stand? Demnach wäre der äußere Ring das jüngere Bauwerk zum Schutz der Burg. Aufgrund der Grabungen und Erkenntnisse des Kunsthistorikers, Architekten und Archäologen Günther Binding vor etwa 60 Jahren galt dies als sicher. Doch neue Forschungen gehen von der umgekehrten Reihenfolge aus. Dies hat der Heidelberger Bauforscher Achim Wendt auf Einladung des Freundeskreises Burg und Stadt Münzenberg erläutert.
Münzenburg ein „Fixstern der Spätromanik“
Laien mögen sich die Frage stellen, weshalb dies interessant sein könnte. In der Fachwelt aber stellt sich diese Frage nicht. Wendt verweist auf die „extrem hohe Forschungsrelevanz der Burg an sich“. Die Münzenburg gelte als eines der wichtigsten Burgendenkmäler der Romanik hierzulande. Historiker datieren den Beginn dieser Epoche in der Architektur auf etwa 950, demnach reichte sie nördlich der Alpen ins 13. Jahrhundert hinein, bis sie von der Gotik mit ihrem himmelwärts reichenden Ansatz abgelöst wurde.
Auch in der gegenwärtigen Mittelalter-Forschung spiele die wegen ihrer beiden Türme volkstümlich „Wetterauer Tintenfass“ genannte Anlage wieder eine große Rolle. Als „Fixstern der Spätromanik“ werde der Ort gefeiert, den Konrad II. von Hagen-Arnsburg zur Mitte des 12. Jahrhunderts im Tausch gegen das Kloster Fulda erworben habe. Dessen Sohn Kuno habe sich schon Hagen-Münzenberg genannt.
Äußere Mauer aus Basalt, innere aus Sandstein
Ganz wesentlich zur Baugestalt der Burg tragen die beiden Ringmauern bei, wie der Bauforscher sagt. Zwei verkoppelte Ringmauern, wie sie dort zu finden seien, gelten nach seinen Worten architekturgeschichtlich als beispiellos. Wendt nennt für diese Zeit neben dem Palas auch die monumentale Bauweise mit beeindruckenden Buckelquadern, die für die innere Mauer verwendet worden seien – wobei diese Mauer am Palas abbreche. Die beiden Ringmauern sind aus dem Westen gut zu erkennen. Die äußere besteht aus grauem Basalt, die erhöht angelegte innere aus helleren Sandsteinen; zudem weist sie Zinnen auf. Nach Meinung von Binding ist die innere Mauer nicht fertiggestellt worden, wie Wendt erläutert.
Vor gut zwei Jahren habe es nach Jahrzehnten wieder einmal die Möglichkeit gegeben, mit fachlich geschultem Auge die Burg und vor allem ihre Mauern genauer anzusehen. Anlass seien Bauarbeiten gewesen – Schlösser und Gärten Hessen als Eigentümer der Anlage und ein Team von Landesarchäologen ergriffen die Chance dazu, die sich andernfalls nicht geboten hätte. Wendt und sein Kollege Matthias Klefenz haben die Ergebnisse ausgewertet.
Die von Binding angeführten Brandereignisse in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sind nach den Worten von Wendt dadurch gut belegt worden. Die meisten Erkenntnisse von Binding behielten ihre Gültigkeit. Die Annahme des späteren Rektors der Universität Köln aber, die äußere Mauer und der westliche Turm seien in Reaktion auf einen Brand entstanden, haben die Archäologen als Ergebnis der neuen Arbeiten widerlegt, wie Wendt sagt.
Denn zum einen zeigten sich Brandschäden am Westturm. Zweitens lagere Brandschutt flächig an der äußeren Mauer. Diese müsse folglich vor einem Brand gestanden haben und könne nicht als Teil eines Wiederaufbaus gelten. Drittens gebe es eine Fuge, an der die innere Mauer nachträglich gegen den äußeren Ring gebaut worden sei. Nach neuen Erkenntnissen war die Burg frühzeitig vollständig von einer Mauer umgeben, wie Wendt hervorhebt. Und nicht unvollständig, wie von Binding angenommen. Der Burgherr Kuno habe sie sogar schnell bauen lassen, der Westturm passe gut dazu.
Buckelquader aus Turm wiederverwendet
Der Bauforscher selbst nimmt nun an, anstelle des runden, von Besuchern begehbaren Ostturms könnte früher ein anderer Turm gestanden haben. Dieser Bau sei mit Buckelquadern hochgezogen, aber wegen eines schwierigen Baugrunds wieder abgetragen worden. Die Quader seien dann für die innere Mauer wiederverwendet worden. „Irgendwo mussten sie ja herkommen“, meint Wendt. Und da habe sich das in der Burg liegende Baumaterial angeboten, so die Annahme. Der später entstandene runde Turm stamme ebenfalls aus romanischer Zeit. Er sei gegen die innere Mauer gesetzt worden. Die innere Mauer zeige dort Spuren von Verwitterung. Sie müsse also zur Zeit des Turmbaus schon gestanden haben.
Den Bau der inneren Mauer mit den monumentalen Zinnen und des Palas begründet der Bauforscher mit der herausragenden Stellung von Kuno. Der Münzenberger sei seit seiner Beförderung zum Reichskämmerer um 1160 im nahen Umfeld von Stauferkaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, gewesen. Bei der weiteren Ausgestaltung der Burg habe er sich an königliche Vorbilder angelehnt. Kuno habe sogar eigene Münzen prägen lassen.