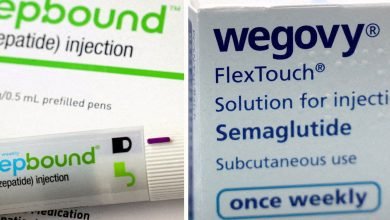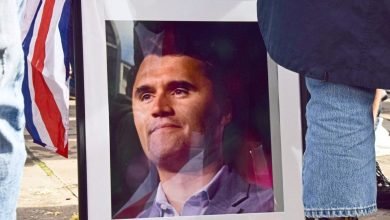Mann oder Frau? Warum ein Gentest im Sport für Streit sorgt – Gesundheit |ABC-Z

Dieses Vorgehen wird heftig kritisiert. Die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sagte dem Sport-Informations-Dienst: „Ein einzelner Gentest klingt nach einer klaren Lösung, ist aber wissenschaftlich verkürzt und blendet aus, dass Geschlecht kein einfaches Entweder-oder ist.“ Auch aus Sicht der Wissenschaft ist die Sache mit den Geschlechtern nicht immer eindeutig. Weil jeder Mensch anders sei, könne man eine klare Trennung nicht so einfach machen, sagt Olaf Hiort, er ist Leiter der Abteilung für Pädiatrische Endokrinologie an der Universität Lübeck und Sprecher des Sonderforschungsbereichs „Geschlechtliche Vielfalt“. Er hält den SRY-Test für „unethisch“.
Den Test, der seit dem ersten September im Leichtathletikverband angewendet wird prüft, ob die Athletinnen das sogenannte SRY-Gen besitzen. SRY steht für sex determining region of Y und befindet sich in der Regel auf dem Y-Chromosom, aber nicht immer. In den meisten Fällen führt ein Y-Chromosom und ein SRY-Gen zu einem männlichen Körperschema.
Aber die Bildung des biologischen Geschlechts ist komplizierter und beginnt etwa in der sechsten Schwangerschaftswoche. Wer das SRY-Gen im Erbgut hat, bildet – sofern das Gen nicht mutiert ist – das sogenannte TDF-Protein. Dieses leitet in der Embyronalentwicklung die Bildung männlicher Geschlechtsorgane ein. Wenn das SRY-Gen aktiv ist und alle biologischen Folgeschritte funktionieren, entwickelt sich normalerweise eine Person mit männlichem Phänotyp – sie hat also Penis und Hoden und ab der Pubertät eine tiefere Stimme und Körperbehaarung. Wenn das Signal des SRY-Gens fehlt, bildet sich im Normalfall ein weiblicher Phänotyp mit Eierstöcken, Vulva und Busen.
Neben dem SRY-Gen gibt es noch viele weitere Gene, die an der Geschlechtsentwicklung beteiligt sind. „Wir kennen heute vielleicht 100 Gene, aber wissen noch nicht, wie viele es tatsächlich sind“, sagt Olaf Hiort.
Wie so oft in der Biologie ist es also nicht ganz so einfach und nicht immer eindeutig. Menschen, die biologisch nicht eindeutig männlich und nicht eindeutig weiblich sind, fasst man in der Bezeichnung DSD zusammen. Sie steht für differences of sex development, also Varianten der Geschlechtsentwicklung.
Verschiedene Faktoren führen zu nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen
Die Entwicklung der sogenannten Keimdrüsen ist vom TDF abhängig. TDF leitet die Entwicklung der Hoden ein, ohne TDF entwickeln sich die Keimdrüsen zu Eierstöcken. Im Hoden bilden sich dann zwei wichtige Zelltypen, die wiederum verschiedene Hormone produzieren. Die einen hemmen die Entwicklung weiblicher Geschlechtsorgane, die anderen produzieren Testosteron, das dann zu dem stärker wirksamen Dihydrotestosteron (DHT) umgewandelt wird. Dieses Hormon ist entscheidend für die Entwicklung der äußeren männlichen Geschlechtsorgane.
Bleiben die Signale für die männlichen Merkmale also aus, bildet sich automatisch ein weiblicher Phänotyp. Es gibt aber auch Menschen mit XY-Chromosomen und sogenannter Gonadendysgenesie, die dann eine Gebärmutter bilden – trotz SRY-Gen.
Manchmal liegt das Problem aber nicht am Hormon selbst, sondern daran, dass der Körper es nicht erkennt. In diesen Fällen liegt eine Mutation im Androgenrezeptor vor, an den Testosteron und DHT normalerweise binden und so die männliche Geschlechtsreifung initiieren. Dann gibt es zwar die nötigen Hormone, aber sie können ihre Wirkung über den Rezeptor nicht weiter geben. Auch in diesem Fall fehlt dem Körper dann das Signal „männlich“ und der Körper bildet automatisch weibliche Merkmale, obwohl ein SRY-Gen im Genom vorhanden ist.
So wie beispielsweise bei der spanischen Hürdenläuferin Maria José Martínez Patiño. Sie hat eine vollständige Androgenresistenz (CAIS), wie die Los Angeles Times berichtete. Das spanische Nationalteam schloss Patiño 1986 aus, nachdem ein Geschlechtstest bei ihr das Y-Chromosom nachgewiesen hatte. Das Chromosom galt lange als eindeutiges Indiz für ein biologisch männliches Geschlecht. Wie viele Menschen von CAIS betroffen sind, ist unklar. Denn kaum jemand weiß, welche Chromosomen er oder sie im Zellkern trägt. Die Betroffenen haben meist innen liegende Hoden, ihnen fehlen Gebärmutter und Eierstöcke. Deshalb bekommen sie auch keine Regelblutung. Nach den neuen Leichtathletikregeln darf eine Person, die nachweislich eine CAIS hat, in der Frauenklasse starten.
Die ersten Geschlechtstests führten die Sportverbände 1946 ein. Diese bestanden damals aus einer Untersuchung der äußeren Geschlechtsorgane. Dass allein das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein eines Penis das Geschlecht bestimmt, ist heutzutage klar widerlegt. Bei Menschen mit DSD können die äußeren Geschlechtsorgane uneindeutig ausgeprägt sein und von „normal“ weiblich bis „normal“ männlich reichen. Laut Olaf Hiort gibt es in Deutschland jährlich rund 100 bis 150 Kinder mit auffälligem Genital.
Rund einer von 20 000 Männern hat zwei X-Chromosomen
Nicht nur die äußeren Geschlechtsorgane können sowohl männliche als auch weibliche Merkmale aufweisen. Beim sogenannten Mosaik wechseln sich im gleichen Körper Zellen mit und ohne Y-Chromosom ab. Wie bei der niederländischen Sprinterin Foekje Dillema. Um an den Leichtathletik-Euopameisterschaften 1950 in Brüssel teilzunehmen, sollte sie einen Geschlechtstest machen. Weil sie diesen verweigerte, sperrte der niederländische Leichtathletikverbund sie auf Lebenszeit. Mit der Zustimmung der Angehörigen führten Wissenschaftler nach ihrem Tod eine DNA-Analyse durch. Sie ergab, dass Dillema ein XX/XY Mosaik aufweist, also die Zellen ihres Körpers sowohl männlich als auch weiblich sind.
1967 führte das Internationale Olympische Komitee Chromosomen-Analysen ein. Mikroskopisch wurde untersucht, ob die Athletinnen zwei X-Chromosomen besaßen. Wären damals auch Athleten getestet worden, die in der männlichen Kategorie starteten, hätte bei manchen der Test „weiblich“ ergeben können. Denn rund einer von 20 000 Männern hat zwei X-Chromosomen. 80 – 90 Prozent jener Fälle tritt auf, weil das SRY-Gen statt auf dem Y-Chromosom auf dem X-Chromosom liegt.
Testosteron ist das bekannteste männliche Sexualhormon. Es wird größtenteils im Hoden gebildet. Aber auch Frauen bilden Testosteron. Das Hormon steuert neben der Entwicklung der Geschlechtsorgane auch Wachstum und den Muskelaufbau.
Männer haben in den meisten Fällen von Natur aus einen höheren Testosteronspiegel. Innerhalb der natürlichen Bandbreite gibt es aber auch Frauenkörper mit höheren Testosteronwerten. Dieser Zustand wird als Hyperandrogenismus bezeichnet. Das kann verschiedene Gründe haben, die nicht immer etwas mit der Geschlechtsentwicklung zu tun haben.
Eine Ursache ist der Alpha-Reduktase-Mangel. Dabei liegt ein Mangel des Enzyms vor, das Testosteron in DHT umwandelt. Weil sich ohne DHT keine männlichen, sondern weibliche Geschlechtsorgane entwickeln, haben betroffene Kinder häufig weibliche Genitalien. In der Pubertät steigt der Testosteronspiegel dann aber stark an. Die Folge: eine tiefere Stimme, Körperbehaarung und eine Zunahme der Muskelmasse.
Das bekannteste Beispiel für Hyperandrogenismus ist die südafrikanische Läuferin Caster Semenya. Sie gewann zwei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und drei Weltmeistertitel über 800 Meter. Nach den entsprechenden Tests verlangte der Leichtathletikverband von ihr, den Testosteronwert künstlich zu senken, um weiterhin in der Frauenkategorie starten zu dürfen.
„Nachlassende Testosteronwirkung bedingt Muskelabbau“, sagt Olaf Hiort. Aber es gebe immer zwei Dinge: einen fundamentalen und einen variablen Teil der Geschlechtsentwicklung. Testosteron ist variabel. Nur den Spiegel zu senken, führt also noch lange nicht zu einer weiblichen Physis.
Der Mediziner findet: „die strikte Binarität im Sport ist – und das zeigt ja die Diskussion –ist nicht ausreichend.“ Der Sport will eine Grenze ziehen, wo die Natur nicht so scharf trennt. Einen klaren Nachweis, der zeigt, ob eine DSD-Athletin einen unfairen Vorteil gegenüber Frauen hat, kann die Wissenschaft dem Sport nicht bieten – und wird es vielleicht auch nie können. Und die Sportverbände selbst, haben auch noch keine Lösungen gefunden, die weniger binär sind. Und so starten die Sportlerinnen und Sportler ab Samstag wie gewohnt in zwei Kategorien: Männer und Frauen.