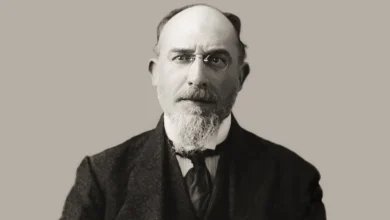Holocaust-Zeitzeugin Regina Sluszny zu Gast bei der Polizei | ABC-Z

An diesem Abend reichen die 300 Plätze im Parkett der Aula der Justus-Liebig-Universität nicht aus. Auch die Empore wird für Besucher geöffnet. Sie alle interessieren sich für die Geschichte von Baronesse Regina Sluszny, die als jüdisches Kind in Belgien vor den Häschern der nationalsozialistischen Besatzer versteckt wurde und den Holocaust überlebt hat. Eingeladen worden ist Sluszny nicht von der Hochschule, sondern von der Gießener Polizei und dem örtlichen Rotary Club Altes Schloss. Am Vormittag hat die Baronesse schon im Präsidium mit Polizisten über ihre Erinnerungen an die Nazizeit geredet.
Im Verlauf des Gesprächs habe niemand auch nur auf sein Handy geschaut oder auch nur getuschelt, sagt Polizeipräsident Torsten Krückemeier. Seit diesem Tag hängt auf dem Flur mit seinem Büro ein sogenanntes Graphic Recording, ein während des Zeitzeugengesprächs entstandenes Bild, das Station des Lebens von Sluszny künstlerisch wiedergibt.
Besucher schwärmen von der Begegnung
Krückemeier ist die treibende Kraft hinter dem Treffen mit der Baronesse und dem Abend in der Uni-Aula, der einem guten Zweck dient. Mit dem Erwerb der Eintrittskarte spendeten die Besucher jeweils einen Betrag. Mit dem Geld sollen die bisher nur auf Englisch veröffentlichten Erinnerungen der 85 Jahre alten Frau ins Deutsche übersetzt und als Buch publiziert werden. Am Ende des Tages ist mehr als genug Geld für die erste Auflage in der Kasse.
Besucher schwärmen hinterher von der Begegnung in der mit mehr als 350 Menschen besetzten Uni-Aula. Auch das Zeitzeugengespräch im Präsidium hallt nach: Beamte möchten die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde und ihren Glauben näher kennenlernen. Der Wunsch mündet in einem Besuch von Krückemeier und Kollegen in der Beith-Jaakov-Synagoge in Gießen zu einem Schabbat-Gottesdienst mit einem anschließenden Essen.
„Die Demokratie ist auf dem Rückzug“
Was aber hat den Polizeipräsidenten in diesem Fall angetrieben? Im Gespräch verweist er auf eine Einladung der European Jewish Association zu einem Treffen abseits der Öffentlichkeit in Amsterdam. „Dort sagten mehrere Juden: Wir wollen Deutschland und Europa verlassen, weil wir uns nicht mehr sicher fühlen.“ In Amsterdam habe er auch die Baronesse kennengelernt. Während eines Besuchs im NS-Vernichtungslager Auschwitz habe er sich dann vergegenwärtigt: „Wir müssen unsere Geschichte und Geschichten lebendig halten, um unsere Demokratie zu schützen und zu erhalten.“
Dabei gehe es ihm nicht um die sogenannte Schuldfrage. Die heutige Generation könne nichts für die zwischen 1933 und 1945 von Deutschen begangenen Untaten. Aber: „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“, zitiert er den spanischen Philosophen George Santayana. Die Polizei habe einen Eid auf die Verfassung geschworen – „aber das ist schon einmal schiefgegangen“, fügt er hinzu.
Wer sich mit Krückemeier eingehender unterhält, merkt bald: Der Mann schaut weit über seinen sogenannten Zuständigkeitsbereich und die Polizeiarbeit hinaus. „Die Demokratie ist allgemein auf dem Rückzug. Wenn aber an unserer Demokratie gerüttelt wird, dann ist wichtig, dass wir uns daran erinnert, wo so etwas hinführt.“ Er tauscht sich nicht nur der Form halber mit Kriminologen aus. Unter Krückemeier geht die Polizei verstärkt auf die Hochschulen zu. Denn die Polizei könne von der Wissenschaft lernen.
Die Polizei muss für die Bürger da sein
Er stellt zudem polizeiliche Statistiken regelmäßig in den gesellschaftlichen Zusammenhang, hebt immer wieder den Charakter der hessischen Ordnungshüter als Vertreter einer Bürgerpolizei hervor. Und den Wert der Freiheitsrechte. „Wenn wir den Leuten den Wert der Freiheitsrechte erklären, dann nützt das nicht nur der Demokratie, sondern am Ende auch der Polizeiarbeit“, meint er. Polizisten als Vertreter dieses Staates müssten dafür eintreten, diesen Staat zu erhalten – egal, gegen wen.
Sie müssten auch für die Bürger da sein. Dabei verstehe er die Ordnungshüter als Schiedsrichter. Doch Polizeiberichte zeigen immer wieder: So mancher Bürger versteht diese Rolle nicht oder will sie nicht akzeptieren. Die Übergriffe auf Beamte wie auf Hilfskräfte zeigen dies ebenso wie das Gaffer-Phänomen nach Unfällen: Statt die Polizei und die Rettungsdienste zu alarmieren, filmten Autofahrer und Passanten immer wieder selbst Verletzte mit dem Handy und stellten den Clip um ein paar Likes willen online.
Dies als Verrohung zu bezeichnen, treffe es ganz gut. Einem Mangel an Einsicht hält Krückemeier entgegen: „Wenn die Polizei zu mir kommt, dann könnte ich mir Gedanken machen, ob ich vielleicht die Ursache dafür gesetzt habe.“