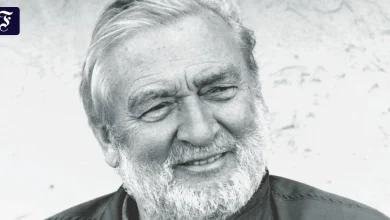Stil
Luxusuhren: Uhrmacher warnt vor Uhren als Investitionsobjekten | ABC-Z

Ich habe mit dem Uhrmacher Rob Nudds über das horologische Jahr gesprochen. Er verrät, was man beim Uhrenkauf sein lassen sollte. Und warum er die Schmeicheleien des Rolex-CEO bei Donald Trump gefährlich findet.