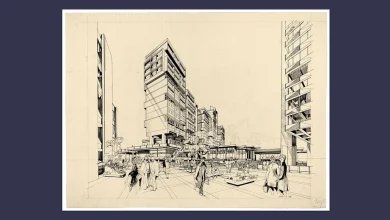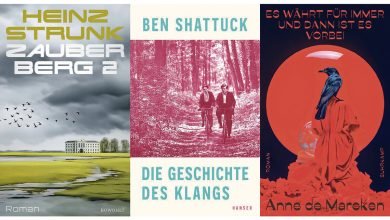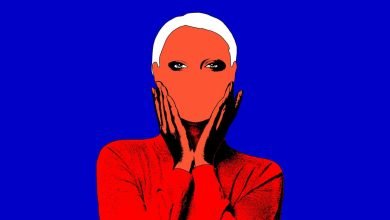Designduo Farresin und Trimarchi: Formafantasma | ABC-Z

Designduo Simone Farresin und Andrea Trimarchi
Formafantasma
Von JASMIN JOUHAR (Text) und STEFAN GIFTTHALER (Fotos)
6. April 2025 · Sie untersuchen Lieferketten für Artek, sie kuratieren Symposien für Prada, sie entwickeln Ausstellungen für die Serpentine Gallery – und rätselhaft-schöne Objekte entwerfen die beiden Formafantasma-Designer auch.
Hier, nordöstlich der Innenstadt, zeigt Mailand sein Alltagsgesicht. Breite Ausfallstraßen, Apartmenthäuser, Bürobauten, Lagerhallen, urbaner Wildwuchs kurz vor der Stadtgrenze. Hier, weit weg von den Showrooms und Geschäften im Zentrum, widerspricht die Stadt ganz entschieden ihrem Image als internationale Mode und Designmetropole. Kein Glanz, kein Glamour, einfach normales Leben, und das kann auch in Italien ziemlich rau aussehen. Erste Außenposten der Kreativindustrie haben sich zwar angesiedelt, prägen das Viertel aber nicht. In einem Industriebau mit blauem Eingangstor haben auch die Gestalter Andrea Trimarchi und Simone Farresin alias Formafantasma ihr Studio. Hier arbeiten die beiden Italiener mit ihrem Team an Projekten für Unternehmen aus der Möbel-, Mode und Luxusgüterindustrie, für Kunst- und Kulturinstitutionen.
Die Entfernung zum geschäftigen Zentrum der Stadt kann man durchaus als programmatisch verstehen. Auch wenn Formafantasma zu den einflussreichsten Designern ihrer Generation gehören – nicht nur in Italien –, haben die beiden stets eine gewisse Distanz bewahrt zu Mailand, dem Kopf und dem Herz der italienischen Designwelt. Erst während der Corona-Pandemie, mehr als zehn Jahre nach der Gründung ihres Studios, richteten sich Farresin und Trimarchi ihr Büro in der Stadt ein. Da hatten sie längst internationale Anerkennung bekommen für ihren forschungsbasierten, ganzheitlichen Gestaltungsansatz, etwa mit der Einzelausstellung „Cambio“ 2020 in der Londoner Serpentine Gallery.
Das Energiezentrum des Studios ist eindeutig Terra, ein graues Windspiel, das unermüdlich durch die rund 300 Quadratmeter große ehemalige Werkshalle saust. Während das Studioteam im hinteren Teil des hohen Raums ruhig und konzentriert hinter den Bildschirmen sitzt, jagt der kleine Hund solange einem Ball hinterher, bis Herrchen Andrea Trimarchi nicht mehr werfen mag. Etwas widerwillig rollt sich Terra in seinem Nestchen auf dem beigefarbenen Sofa zusammen. Trimarchi, melierter Vollbart zum dunkelgrauen Blouson, ist der Joviale, Offene des Duos. Simone Farresin wirkt reservierter und etwas streng in seinem Sakko mit den extrabreiten Schultern, taut aber im Gespräch zusehends auf. Der 41 Jahre alte Trimarchi stammt ursprünglich aus Sizilien, der zwei Jahre ältere Farresin vom entgegengesetzten Ende Italiens, aus der Nähe von Vicenza in der Region Venetien. Kennengelernt haben sich die beiden, die auch privat ein Paar sind, 2005 beim Studium in Florenz. Auf die Frage, wie sie ihre vielfältige Arbeit einem Laien erklären würden, müssen sie kurz überlegen. „Das Einfachste, was wir machen, ist Produktdesign“, sagt Trimarchi schließlich. „Aber wir machen auch komplexere Dinge wie Ausstellungsgestaltung und Szenografien. Und wir beraten Marken, Agenturen, Institutionen.“ Farresin ergänzt: „Wir formen Dinge.“
Die ganze Bandbreite ihres Schaffens ist auf der diesjährigen Mailänder Designwoche zu sehen. Etwa beim italienischen Leuchtenhersteller Flos: Formafantasma haben sowohl den Stand auf der Messe Euroluce gestaltet als auch den Mailänder Showroom des Unternehmens, wo sie ihre Leuchtenkollektion Superwire zeigen.
Unkonventioneller ist da schon das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Möbelhersteller Cassina, für den Farresin und Trimarchi eine Installation in einem Theater konzipiert haben. Die raumgreifende Inszenierung „Staging Modernity“ konfrontiert die ikonischen Cassina-Möbel von Le Corbusier, Charlotte Perriand und Pierre Jeanneret nicht nur mit allerlei Getier. Sie wird auch mehrfach mit eigens dafür entwickelten Performances bespielt. Und nicht zuletzt haben Formafantasma wieder ein Designsymposium für das Modeunternehmen Prada kuratiert. Bei der vierten Ausgabe der ausverkauften „Prada Frames“ ging es um Mobilität, Schauplatz war unter anderem der restaurierte Arlecchino-Zug, einst von der italienischen Designlegende Gio Ponti gestaltet.
Formafantasma sind die wohl prominentesten Vertreter eines zeitgenössischen Designansatzes, der Objekte nicht zwingend in den Mittelpunkt stellt, sondern die Bedingungen von Gestaltung hinterfragt. Welche Materialien werden eingesetzt? Welche ökologischen und sozialen Auswirkungen hat die Herstellung? „Wir lieben Objekte“, sagt Simone Farresin. Sein Partner weiter: „Wir interessieren uns für die Macht der Objekte. Sie sind wie trojanische Pferde. Sie transportieren Bedeutung.“
Um die Hintergründe der Objekte sichtbar zu machen, setzen Formafantasma oft auf extensive Recherche. Wenn es ihnen ein Auftrag ermöglicht, steigen sie tief ein in ein Thema, beschäftigen mehrere Mitarbeiter im Studio für ein Jahr oder länger mit Forschung. Sie führen Interviews mit Experten aus verschiedenen Disziplinen, sie gehen in Archive und erwerben so viel Wissen wie möglich. Wie bei der Ausstellung „Cambio“, für die sie sich im Auftrag der Serpentine Gallery mit Holz beschäftigten – mit Waldwirtschaft, Holznutzung und Ökosystemen. Der enormen Bedeutung dieses Materials für die Menschheit näherte sich die Ausstellung multiperspektivisch, aus historischen und naturwissenschaftlichen, ethnologischen und ökonomischen Blickwinkeln.
„,Cambio‘ war ein Schlüsselmoment für uns“, sagt Trimarchi. In den Jahren zuvor hätten sie viel darüber nachgedacht, wer sie als Designer seien und mit welchen Mitteln sie sich ausdrücken könnten. Die Einladung der Serpentine Gallery war dann die Chance, die theoretischen Überlegungen in die Praxis umzusetzen, mit der Ausstellung, dem Katalog und einer Gesprächsreihe. Zuvor hatten Formafantasma für die Ausstellung „Ore Streams“ (2017) schon die Abfallströme der Elektronikindustrie untersucht – und Elektroschrott zu auratischen Möbelstücken weiterverarbeitet. Zudem konnten sie ein Forschungsprojekt zum Material Wolle umsetzen und erstmals 2023 in Form der Ausstellung „Oltre Terra“ im Nationalmuseum in Oslo zeigen. Die Schau ist aktuell im Stedelijk Museum in Amsterdam zu sehen.
Für „Botanica“ (2011) entwarfen Formafantasma ein spekulatives Szenario ohne Erdöl-basierte Kunststoffe.Foto: Unternehmen
Zum Erfolg ihres durchaus sperrigen Designansatzes hat sicher beigetragen, dass Formafantasma ihren Projekten eine prägnante und stark stilisierte Ästhetik verleihen. Sie gelten als Perfektionisten, was ihre rätselhaft schönen Fotos, Videos und Objekte immer wieder beweisen. Schon die ersten Projekte zeigten das Talent der Designer, mit ungewöhnlichen Texturen, Materialkombinationen und Formen eine starke visuelle Anziehungskraft zu erzeugen, etwa „Botanica“ von 2011, eine Auseinandersetzung mit Kunststoffen natürlichen Ursprungs, oder „Craftica“ für Fendi von 2012, für das Formafantasma mit Leder, aber auch mit Knochen, Tierblasen und echten Schwämmen arbeiteten.
In ihrem Studio sind einige der „Craftica“-Objekte zur Schau gestellt, neben anderen Entwürfen wie einem der gläsernen Still-Gefäße für die Glasmanufaktur Lobmeyr. Formafantasma nutzen den zurückhaltend mit hellen Holzmöbeln und Einbauten eingerichteten Raum nicht nur als Arbeitsort, sondern auch als Bühne, um Relikte aus der Forschung und Produkte zu inszenieren. Über dem Besprechungstisch schweben zwei Exemplare ihrer Leuchte Wireline für Flos, darunter auf dem Tisch zwei Vasen aus der Clay-Serie für Bitossi. Auf der Fensterbank steht eine der neuen Superwire-Leuchten, ebenfalls für Flos, und die Studioküche ist gefliest mit ihren Excinere-Fliesen der Marke Dzek, für deren Glasur Formafantasma vulkanische Asche verwendet haben. Was als Recherche beginnt, führt bei dem Duo nicht nur zu Ausstellungen, Publikationen, Gesprächsreihen oder Einzelstücken mit Sammlerwert, sondern immer wieder auch zu Projekten mit Unternehmen aus der Industrie.
Vier Jahre Entwicklungsarbeit stecken in der Superwire-Leuchte für Flos.Foto: Unternehmen
Marianne Goebel etwa, die Geschäftsführerin des finnischen Möbelhersteller Artek, lud Andrea Trimarchi und Simone Farresin zur Zusammenarbeit ein, nachdem sie durch „Cambio“ auf die Recherchen zur Holzindustrie aufmerksam geworden war. Artek ist bekannt für die Möbel von Alvar und Aino Aalto, die das Unternehmen in den Dreißigerjahren mitgegründet hatten. „Artek hat etwas, was viele andere nicht haben, eine Beziehung zu einem Ökosystem“, sagt Farresin. Denn das Unternehmen produziert viele seiner Möbel in einer eigenen Fabrik in Finnland, mit Birkenholz aus einheimischen Wäldern.
„Die Perspektive eines Ingenieurs ist es, ein System zu perfektionieren. Wir wollen nicht perfektionieren, wir wollen verändern.“
SIMONE FARRESIN
Das mag per se schon einmal nachhaltig klingen, doch für Formafantasma war da mehr Potential. Sie untersuchten die ganze Lieferkette von der Birke im Wald bis zum fertigen Stuhl, setzten sich mit Herstellungsverfahren und Produktportfolio auseinander. Eine Erkenntnis: Im Laufe der Jahrzehnte hat das Unternehmen immer strengere Kriterien bei der Auswahl des Holzes angewendet. Während frühe Stool-60-Hocker von Alvar Aalto noch Astlöcher und andere Unregelmäßigkeiten aufwiesen, sind die heute hergestellten sehr hell und ebenmäßig. Das bedeutet, dass in der Fabrik große Mengen der wertvollen Ressource Holz aussortiert werden – während durch die Auswirkungen des Klimawandels die Schäden an den Bäumen eher zunehmen. Gemeinsam mit dem Team von Artek entwickelten Trimarchi und Farresin deshalb eine „inklusivere Holzauswahl“, wie sie es nennen. Einige der Aalto-Klassiker gibt es jetzt als „Wild Birch“-Version mit Astlöchern, Fraßspuren von Insekten und dunkleren Partien. Auf die Frage, warum es für so ein Projekt überhaupt externe Designer brauchte und ob das nicht auch die Artek-Mitarbeiter selbst hätten entwickeln können, lacht Simone Farresin. „Die Perspektive eines Ingenieurs ist es, ein System zu perfektionieren. Wir wollen nicht perfektionieren, wir wollen verändern.“
Die berühmten Artek-Hocker Stool 60 in der „Wild Birch“-Version von FormafantasmaFoto: Unternehmen
Die aktuelle Leuchtenkollektion Superwire für Flos resultierte ebenfalls aus einem Forschungsprojekt, aus „Ore Streams“. Doch es dauerte wesentlich länger, die Erkenntnisse darüber, wie Elektroschrott verwertet wird, in ein Produkt umzusetzen. „Wir wollten damals schon mit Elektronikherstellern zusammenarbeiten, aber es stellte sich als sehr schwierig heraus“, sagt Trimarchi. Flos dagegen zeigte sich offen, als die beiden Designer vorschlugen, eine Leuchte nach den Prinzipien der Reparierbarkeit zu entwerfen. Dennoch dauerte es vier Jahre bis zur Marktreife. Denn die Glasleuchten lassen sich dank frei zugänglicher Verschraubung nicht nur einfach zerlegen. Auch das LED-Leuchtmittel kann vom Besitzer selbst ausgetauscht werden, ohne die Leuchte zurück zu Flos zu schicken. Dafür mussten die Designer jedoch mit dem Flos-Team eigens ein Leuchtmittel entwickeln. Es gab keine Standard-LEDs, die die Ansprüche an Reparierbarkeit erfüllt hätten.
Stuhl aus dem „Ore Streams“-Projekt, hergestellt mit Teilen aus ElektroschrottFoto: Unternehmen
„Wir waren immer an den Rändern, und wir kamen erst nach Mailand, als wir uns
damit wohlfühlten.“
SIMONE FARRESIN
Mit ihrer Arbeit für Flos und Möbelfirmen wie Cassina und Tacchini sind Formafantasma endgültig im Zentrum der italienischen Designwelt angekommen, bei aller räumlichen Distanz zur Mailänder Innenstadt. Nach dem Studium in Florenz waren die beiden zusammen an die Designakademie Eindhoven gewechselt, bis heute eine der wichtigsten Hochschulen für experimentelle und forschungsbasierte Gestaltung und damit ein guter Ort für junge, kritische Köpfe. Und doch war der Umzug in die Niederlande auch eine Art Flucht vor dem übermächtigen Erbe der italienischen Designkultur. Das geben beide unumwunden zu. Nach dem Abschluss blieben sie in den Niederlanden und gründeten 2009 ihr Studio. Erst als sie eine eigene Sprache und Ästhetik entwickelt und sich international etabliert hatten, entschieden sie sich für den Umzug nach Mailand. Bis heute unterhalten sie ein Studio in Rotterdam. „Wir waren nie Teil der Mailänder Szene“, sagt Farresin. „Wir waren immer an den Rändern, und wir kamen erst nach Mailand, als wir uns damit wohlfühlten.“ Dass sie jetzt am richtigen Ort sind, daran besteht für das Duo aber kein Zweifel. Denn, so Farresin, „wir wertschätzen die Vergangenheit als Quelle für Wissen und Ästhetik“. Damit fühlen sie sich viel mehr als Teil der italienischen Designkultur als der niederländischen.