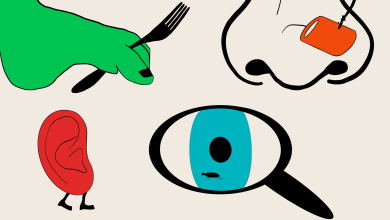Pflegeheime unzureichend auf Hitzewellen vorbereitet | ABC-Z

Am Mittwoch soll das Thermometer bis auf 38 Grad klettern, in einigen Regionen ist auch die 40-Grad-Marke möglich. Besonders gefährdet bei hohen Temperaturen sind vulnerable Gruppen wie Kleinkinder, wohnungslose und suchtkranke, aber auch alte Menschen. Viele von ihnen leben in Pflegeeinrichtungen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts werden rund 800.000 Personen in Deutschland in vollstationären Pflegeheimen versorgt – und die sind der extremen Hitze in den meisten Fällen nicht gewachsen.
Alte Gebäude halten die Hitze nicht ab
„Wir haben die Pflegeeinrichtungen nicht ausreichend auf den Klimawandel vorbereitet“, kritisiert Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. „Oft gibt es nicht einmal eine Außenbeschattung. Schon diese einfachen Maßnahmen sind meist gar nicht vorhanden, um klimatechnisch ins nächste Jahrzehnt zu kommen.“ Brysch fordert weitreichende Investitionen und nimmt vor allem die Politik in die Pflicht: „Das große Problem sind die Schutzdefizite bei älteren Gebäuden. Da liegt die Investitionsverantwortung eindeutig bei den Ländern. Der Bund muss hier aber auch Mitverantwortung übernehmen. Es braucht für jedes Haus ein Klimakonzept – bei Neubauten, aber auch bei Altbauten.“
Auch der Sozialverband VdK kritisiert, dass viele Pflegeeinrichtungen nicht ausreichend auf Hitzewellen vorbereitet sind. „Ein Hitzeschutzplan für Einrichtungen wie Pflegeheime und Krankenhäuser ist essenziell, um die Bewohner und die Mitarbeitenden vor den gesundheitlichen Risiken extremer Hitze zu schützen“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele.
Marlene Mann vom Bundesverband Volkssolidarität bemängelt, dass zwar oftmals Hitzeschutzkonzepte vorhanden sind, diese aber nur langsam realisiert werden: „Bis zur Umsetzung von Maßnahmen vergeht so viel Zeit, zumal ein umfangreicher Analyseprozess für jede Einrichtung erforderlich ist, der selbst etwa ein Jahr in Anspruch nimmt.“
Hohe Temperaturen erhöhen die Sterblichkeit
Pflegebedürftige Personen sind bei extremer Hitze oft nicht in der Lage, selbst für ausreichende Entlastung des Körpers zu sorgen. Bei bettlägerigen Personen können Materialien wie Decken und Kissen die Wärmebelastung zusätzlich verstärken. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt weist darauf hin, dass im Alter die Schweißproduktion abnimmt und oft zu wenig getrunken wird. Dadurch kann der Körper weniger Wärme abgeben, es kommt zu Dehydrierung und Elektrolytverlust.
Wegen hitzebedingter Krankheitssymptome kommen jährlich zahlreiche Personen ins Krankenhaus. In den vergangenen Jahren wurden rund 1400 Personen pro Jahr wegen gesundheitlicher Schäden durch Hitze in Krankenhäusern behandelt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Bei den Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte aus den Jahren 2003 bis 2023. Todesfälle mit Hitze als Todesursache sind jedoch relativ selten. Im Durchschnitt gab es in Deutschland demnach 22 solcher Todesfälle pro Jahr.
Sehr hohe Temperaturen ließen die Sterblichkeit jedoch insgesamt steigen, da in vielen Fällen die Kombination aus Hitze und Vorerkrankungen das Sterberisiko erhöhe. So kommt es zu überdurchschnittlich vielen hitzebedingten Krankenhausbehandlungen an Tagen mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz betrachtet solche Zahlen kritisch: „Bei älteren Menschen ist die Todesursache meistens eine Kombination gesundheitlicher Aspekte. Da kann die Hitze das Fass zum Überlaufen bringen. Bei den Sterbefällen werden diese Toten aber nicht gesondert erfasst.“
Kritik kommt auch aus der Politik
Auch Politiker drängen auf ein Nachrüsten in Pflegeeinrichtungen. Helge Benda von der Seniorenvereinigung der CDU fordert Notfallpläne, Warnsysteme und bessere Betreuungskonzepte: „Es darf nicht sein, dass Pflegeheime bei 35 Grad nur Ventilatoren aufstellen, während Bewohner darin dehydrieren.“ Nötig seien auch „verbindliche Hitzeschutzpläne in allen Kommunen bis zum Jahresende“. Obwohl die Ländergesundheitsminister im Jahr 2020 entsprechende Beschlüsse gefasst hätten, sei bisher zu wenig geschehen.
Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, glaubt, dass angesichts der Klimaerwärmung kein Weg an der Installation von Klimaanlagen in Krankenhäusern und Seniorenheimen vorbeiführt. „Wir brauchen sie einfach. Punkt“, sagte Schulze am Dienstag in München. „Mir leuchtet es nicht ein, wie man gegen eine Klimaanlage sein kann, wenn es so heiß ist.“
Auch aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG), die in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse vor Todesfällen aufgrund der hohen Temperaturen warnt, unternimmt Deutschland bisher zu wenig, um alte Menschen vor extremer Hitze zu schützen. „In zuletzt nur 25 von mehreren Tausend Kommunen gibt es derzeit Hitzeaktionspläne, die zudem kaum oder keine Maßnahmen für extreme Hitzeereignisse wie einen Hitzedom enthalten“, sagt Autor Clemens Becker vom Universitätsklinikum Heidelberg.
Die Stadt Mannheim ist Vorreiter
Als positives Beispiel ist Mannheim zu nennen – die Stadt hat einen solchen Hitzeaktionsplan implementiert. Nach einer Erhebung der Deutschen Umwelthilfe (DUH), dem sogenannten Hitze-Check, ist Mannheim eine der Städte in Deutschland, die am stärksten von Hitze betroffen sind. Der 2021 ausgearbeitete Hitzeaktionsplan der Stadt berücksichtigt auch die Versorgung vulnerabler Gruppen. In Pflegeheimen zählt dazu unter anderem eine gezielte Schulung des Pflegepersonals oder das Einführen von Trinkprotokollen für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
„Repräsentanten aus den Pflegeeinrichtungen sind bei uns Teil der Gremien und geben uns Rückmeldung, was sie im Rahmen des Hitzeaktionsplans benötigen“, sagt Koordinatorin Alexandra Idler. „Oftmals wünschen sich die Einrichtungen Unterstützung bei baulichen Investitionen und Verschattungselementen, also mit Jalousien, Sonnensegeln oder Sonnenschirmen. Es gibt auch Entsiegelungs- und Begrünungsprogramme, die die Temperatur im Außenbereich senken sollen.“
Doch auch ein bis ins Detail ausgearbeiteter Hitzeaktionsplan kommt an seine Grenzen, wenn das Geld fehlt. „Was an finanziellem Budget zur Verfügung steht, entscheidet die Kommune“, so Idler. „Damit steht und fällt dann auch die Umsetzung. Wir können nur in dem Maße Verschattungselemente installieren, wie wir auch Geld zur Verfügung haben.“