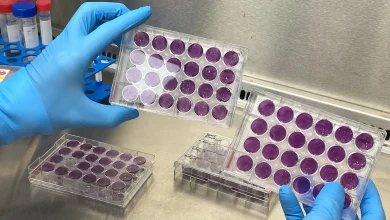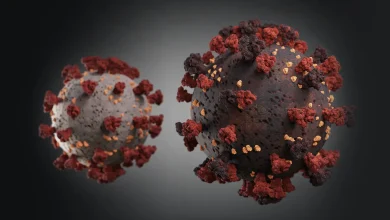Alzheimer-Demenz: Symptome, Diagnose und Behandlung mit Medikamenten | ABC-Z

Video:
Alzheimer-Demenz: Neue Therapieansätze machen Hoffnung (7 Min)
Stand: 16.09.2025 08:16 Uhr
| vom
Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. Heilung ist noch nicht in Sicht – neue Medikamente sollen das Fortschreiten der Erkrankung verzögern. Sie sind aber nicht unumstritten.
In Deutschland leben nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz – die meisten von ihnen sind an Alzheimer erkrankt. Nach Prognosen der Experten wird sich die Zahl aufgrund der demografischen Entwicklung bis zum Jahr 2050 auf bis zu 2,7 Millionen Betroffene erhöhen.
Demenz ist der Oberbegriff für unterschiedliche Erkrankungen, bei denen die Gehirnleistung beeinträchtigt ist. Die Alzheimer-Krankheit ist die weltweit häufigste Form der Demenz: Zwei Drittel aller dementen Menschen sind an Alzheimer erkrankt. Die fortschreitende, neurodegenerative Erkrankung betrifft vor allem Menschen im Alter über 65 Jahre, eine Heilung gibt es bislang nicht.
Symptome der Alzheimer-Demenz
Die Erkrankung des Gehirns verläuft erst viele Jahre unbemerkt. Die Symptome der Alzheimer-Demenz zeigen sich erst im späteren Verlauf und können von Person zu Person variieren.
- Gedächtnisprobleme: Ein charakteristisches Frühsymptom der Alzheimer-Demenz ist das Vergessen von zeitnahen Ereignissen, das Kurzzeitgedächtnis kann soeben Gehörtes nicht weiterverarbeiten. Später haben Betroffene auch Schwierigkeiten, sich an wichtige Informationen zu erinnern, die sie früher leicht abrufen konnten.
- Veränderungen im Denkvermögen: Bei einer Alzheimer-Demenz treten kognitive Beeinträchtigungen auf – zum Beispiel nimmt die Fähigkeit zu denken, zu planen und zu urteilen ab. Das Lösen von Problemen oder das Verstehen komplexer Zusammenhänge macht zunehmend Schwierigkeiten.
- Wortfindungsprobleme: Es kann zu Wortfindungsstörungen (Aphasie) kommen. Dabei fällt es schwer, Worte zu finden oder sich flüssig auszudrücken. Das kann bei von Alzheimer Betroffenen zu Verwirrung und Frustration führen.
- Desorientierung: Menschen mit Alzheimer können sowohl zeitlich als auch räumlich desorientiert sein. Sie wissen dann nicht mehr, welcher Tag oder Monat ist – oder sie verirren sich in ihrer vertrauten Umgebung.
- Probleme bei Alltagsaufgaben und Selbstversorgung: Alltägliche Aktivitäten wie Anziehen, Körperpflege, sichere Mobilität oder Kochen und Essen können Betroffenen plötzlich schwerfallen. Diese sogenannte Apraxie tritt häufig im fortgeschrittenen Stadium einer Alzheimer-Erkrankung auf.
- Veränderungen im Verhalten und der Persönlichkeit: Eine Alzheimer-Demenz kann bei den Betroffenen zu Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Aggressivität und sozialem Rückzug führen. Diese Verhaltensänderungen erschweren die Kommunikation und das Zusammenleben mit Betroffenen.
- Halluzinationen und Delirien: Manche von Alzheimer Betroffene erleben Fehlwahrnehmungen (Halluzinationen) oder sind verwirrt (Delir), was bei ihrer Betreuung zu zusätzlichen Herausforderungen führen kann.
Ursachen der Alzheimer-Demenz
Die Alzheimer-Demenz wird wahrscheinlich durch verschiedene schädliche Abläufe im Gehirn und ihre Wechselwirkungen verursacht.
- Amyloid-Klümpchen im Gehirn: In einem gesunden Gehirn kommunizieren die Nervenzellen über Botenstoffe – das ermöglicht es, zum Beispiel Erinnerungen abzuspeichern. In den Gehirnen von Alzheimer-Erkrankten sammeln sich zwischen den Nervenzellen Proteinstückchen (Amyloid-Beta), die zu unlöslichen, giftigen Fasern verkleben und den Nervenzellen schaden. Allmählich entstehen auch größere Ablagerungen, sogenannte Amyloid-Plaques.
- Tau-Protein-Verwicklungen: Ein weiteres typisches Merkmal von Alzheimer ist die Anhäufung von sogenannten Tau-Proteinen in den Gehirnzellen. Diese verdrehten und faserigen Proteine (Fibrillen) lassen die Zellen absterben und zerstören Nervenverbindungen. Bereiche des Gehirns, die zum Beispiel für das Gedächtnis zuständig sind, schrumpfen. Eine Studie am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) aus dem Jahr 2022 hat gezeigt, dass die Tau-Proteine dabei mit den Amyloid-Ablagerungen zusammenwirken.
- Entzündungsreaktionen: Anhaltende Entzündungsprozesse im Gehirn können Schäden an den Nerven verursachen und die Krankheit vorantreiben.
- Infektionen: Verschiedene Viren und Bakterien könnten an der Entstehung von Alzheimer beteiligt sein, insbesondere wenn sie Entzündungen an Nerven im Gehirn auslösen. Studiendaten zeigen, dass Impfungen gegen bestimmte Erreger das Alzheimer-Risiko reduzieren, gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten-, gegen Herpes Zoster Viren (Gürtelrose) sowie gegen Pneumokokken (Bakterien, die Lungenentzündungen, Mittelohrentzündungen oder auch Hirnhautentzündungen auslösen können), aber auch gegen Grippe.
Risikofaktoren: Wer ist gefährdet?
Forschende konnten außerdem einige Faktoren identifizieren, die das Risiko für eine Alzheimererkrankung erhöhen:
- Genetische Faktoren: Es gibt bestimmte Genvarianten, die das Risiko für Alzheimer erhöhen. Dazu zählt vor allem der sogenannte ApoE4-Genotyp. Kommt Alzheimer in der Familie vor, ist das individuelle Risiko ebenfalls erhöht.
- Alter: Das Alter ist der wichtigste Risikofaktor für Alzheimer. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken.
- Geschlecht: Studien deuten darauf hin, dass Männer ein höheres Alzheimer-Risiko haben als Frauen. Bisher galten Frauen als häufiger betroffen.
- Soziale Faktoren: Auch soziale Faktoren wie geringes Einkommen, ein niedriger Bildungsstand und allein zu leben sind mit einem höheren Alzheimer-Risiko verbunden.
- Starke Schwerhörigkeit: Gravierende Hörprobleme können zu sozialer Isolation und verringerter geistiger Stimulation führen, was mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko verbunden ist.
- Durchblutungsstörungen: Weitere Risikofaktoren sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, hoher Blutdruck und hohe Cholesterinwerte. Diese Erkrankungen können die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigen und somit das Risiko für Alzheimer erhöhen.
- Umwelt und Lebensweise: Eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung, ausreichend körperlicher Aktivität und geistiger Stimulation kann das Risiko für eine Alzheimer-Demenz verringern. Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und eine ungesunde Ernährung können das Risiko hingegen erhöhen.
Gürtelrose-Impfung: Hinweise auf geringeres Risiko für Demenz
Von den empfohlenen Impfungen zur Vorbeugung von Entzündungen im Gehirn scheint vor allem die Impfung gegen Herpes Zoster (Gürtelrose) gute Ergebnisse zu erzielen. Laut einer im April 2025 im Fachmagazin “Nature” veröffentlichten Studie sank das Demenz-Risiko mit der Impfung um etwa 20 Prozent. Ein internationales Forschungsteam analysierte Gesundheitsdaten von 280.000 älteren Menschen, die in Wales an einem Impfprogramm teilgenommen hatten. Der Schutzeffekt schien bei Frauen größer zu sein als bei Männern. Größere Gewissheit könnte eine große randomisierte, kontrollierte Studie bringen. Auch ist noch nicht erforscht, wie genau der Gürtelrose-Impfstoff einer Demenz entgegenwirkt.
Diagnose und Verlauf der Alzheimer-Demenz
Oftmals wird Alzheimer-Demenz erst diagnostiziert, wenn bereits deutliche Symptome auftreten sind. In der Regel ist das Gehirn dann schon stark geschädigt und Betroffenen leben durchschnittlich nur noch weniger als zehn Jahre – auch wenn der Verlauf sehr individuell ist. Eine frühzeitige Diagnose soll nicht nur die Behandlungsmöglichkeiten verbessern. Betroffene und ihre Familien könnten rechtzeitig geeignete Unterstützung beim Umgang mit der Erkrankung suchen. Die Pflege von Menschen mit Alzheimer erfordert viel Geduld, Verständnis und spezialisierte medizinische Betreuung, um die Lebensqualität der Betroffenen so gut wie möglich zu erhalten. Bislang erfolgt die Diagnose der Erkrankung durch Gedächtnis-Tests, eine Nervenwasseruntersuchung (Liquor- oder Lumbalpunktion) auf die Proteine Amyloid und Tau und eine Bildgebung des Gehirns (MRT/CT).
Diagnose: EU-Zulassung für Bluttests
Forschende arbeiten daher an der Entwicklung sicherer Frühtests, die bereits vor Eintritt der Demenz Hinweise auf die Alzheimer-Krankheit geben, wenn das Gehirn noch nicht stark geschädigt ist. Der sogenannte Precivity-Bluttest aus den USA kann bei ersten Symptomen nachweisen, ob es sich um eine Alzheimer-Demenz handelt, indem er das Verhältnis von zwei Amyloid-Proteinen zueinander ermittelt. Der Elecsys pTau181-Test misst das chemisch veränderte Tau-Protein, das als Alzheimer-Indikator gilt. Beide Bluttests haben inzwischen eine EU-Zulassung. Der Einsatz in der Praxis wird vorbereitet.
Behandlung von Alzheimer-Demenz
Zur Behandlung der Alzheimer-Demenz stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. Zum einen sogenannte Cholinesterase-Hemmer wie die Wirkstoffe Donepezil, Galantamin oder Rivastigmin, die die Botenstoffe im Gehirn vermehren und dadurch die geistige Leistungsfähigkeit steigern, zum anderen Glutamat-Antagonisten, wie Memantin, die bei weiter fortgeschrittener Demenz eingesetzt werden. Diese Medikamente können Symptome lindern und das Fortschreiten leicht verzögern. Auf den Untergang der Nervenzellen haben diese Mittel aber keinen Einfluss. Häufig leiden Alzheimer-Erkrankte auch an Depressionen, die mit Antidepressiva behandelt werden. Mit regelmäßigen neuropsychologischen Tests lässt sich der Verlauf der Alzheimer-Demenz beobachten.
Neues Medikament jetzt in Deutschland erhältlich
Mittlerweile gibt es erste Medikamente, die die schädlichen Prozesse im Gehirn direkt beeinflussen und die Alzheimer-Erkrankung im Entstehungsprozess bremsen sollen. Der Antikörper-Wirkstoff Lecanemab ist seit 1. September 2025 in Deutschland auf dem Markt. Für den Antikörper Donanemab hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA im Juli eine Zulassungsempfehlung erteilt. Die Antikörper richten sich gegen die Amyloid-Stückchen, so dass diese vom Immunsystem beseitigt werden können, bevor sie Schaden anrichten. So zeigt eine Studie von 2023, dass Donanemab das Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung um 35 Prozent verlangsamen kann. Bereits eingetretene Symptome können nicht beeinflusst werden. Daher ist der Einsatz nur sinnvoll bei Menschen mit Alzheimer-Erkrankung im Frühstadium oder mit nur leichter kognitiver Störung.
Weitere Voraussetzungen für eine Antikörper-Therapie:
- Neuropsychologische Tests zur Diagnosesicherung
- Nachweis von Alzheimer-Proteinen im Nervenwasser (alternativ: Nachweis von Amyloid in einer speziellen Bildgebung, der Positronenemissionstomografie (Amyloid-PET))
- Bildgebung vom Gehirn: Während der Therapie müssen regelmäßig MRT-Untersuchungen gemacht werden, um mögliche Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen zu entdecken.
- Gentest auf die Genvariante ApoE4. In seltenen Fällen liegt dieses Gen doppelt vor, dann ist das Risiko für Nebenwirkungen zu hoch.
- Keine Einnahme von stark wirkenden Medikamenten zur Hemmung der Blutgerinnung (zum Beispiel Marcumar oder Apixaban), da das Risiko für Blutungen im Gehirn zu groß ist. Das gilt nicht bei der Einnahme von ASS.
Experten schätzen, dass die neue Therapie für bis zu 73.000 Menschen in Deutschland in Frage kommt.
Nebenwirkungen der Alzheimer-Medikamente
Die neue Antikörper-Therapie bei Alzheimer-Demenz ist nicht unumstritten. Zum einen ist sie sehr aufwendig: Der Wirkstoff muss den Erkrankten alle zwei bis vier Wochen über die Dauer von zwei Stunden intravenös verabreicht werden. Zum anderen können erhebliche Nebenwirkungen auftreten wie Blutungen und Schwellungen (Ödeme) im Gehirn, die sogar tödlich verlaufen können. Einige Expertinnen und Experten halten das Risiko im Vergleich zum Nutzen für zu groß.
Auch die Kosten sind sehr hoch: So wird der Antikörper Lecanemab pro behandelter Person voraussichtlich etwa 20.000 bis 30.000 Euro im Jahr kosten. Hinzu kommen Kosten für die engmaschigen Untersuchungen aufgrund der möglichen Nebenwirkungen. Einig sind sich viele Expertinnen und Experten jedoch darüber, dass die Antikörper-Therapie einen wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu einer ursächlichen Behandlung von Alzheimer-Demenz darstellt.