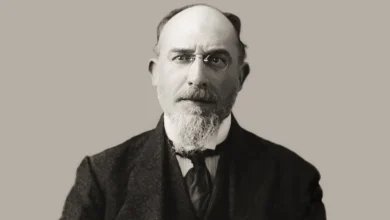Wohnen
Korallenriffe gefährdet: Globale Korallenbleiche erreicht Rekordhöhe | ABC-Z

29. April 2025 | Lesezeit: 4 Min.
Im seichten, warmen Wasser ragen leuchtend gelbe Tentakel aus dem Ozeanboden und wiegen sanft im Rhythmus der Wellen. Krebse, Oktopusse und unzählige Fische in Regenbogenfarben tummeln sich darum, knabbern neugierig an den Kalkschalen der Korallen. Oder sie verstecken sich vor gefräßigen Muränen mit dutzenden Reihen scharfer, durchsichtiger Zähne. Die Szenen wie die aus einer Naturreportage der National Geographic zeigen: Korallenriffe sind fantastische Unterwasserwelten. Doch sie sind gefährdet – heute mehr denn je.