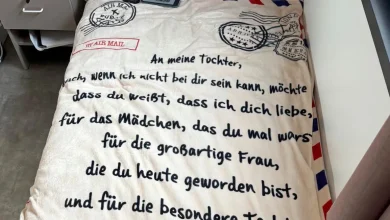Diesen Plan hat Kauczinski mit dem TSV 1860 im Trainingslager | ABC-Z

Markus Kauczinski saß im Flugzeug nach Antalya als einziger Löwe alleine. Der Staff und die Spieler waren in der Maschine, die am Samstagmorgen um 9.30 Uhr in die Türkei aufbrach, gesammelt mehrere Reihen hinter dem Cheftrainer. “Ich bin sozial verträglich”, versicherte der gut gelaunte Kauczinski bei einer Presserunde am Samstagabend im Susesi-Sportzentrum und lachte. “Vielleicht wollte mich keiner erdulden.”
Kauczinski: “Es gehen noch viele Dinge besser”
Das wäre durchaus schlecht. Immerhin soll er bis kommenden Samstag die Löwen in Belek optimal auf die Rückrunde vorbereiten. Was wirklich hinter dem Einzelplatz für Kauczinski steckte? “Das hat sich einfach so ergeben”, antwortete der 55-Jährige. Also, alles halb so schlimm. So hatte Kauczinski auf dem Flug noch ein bisserl Zeit, sich Gedanken über den Trainingsplan zu machen.
Der Coach will darauf aufbauen, was er in seinen ersten Monaten beim TSV 1860 geschaffen hat. “Ich bin zufrieden, dass etwas vorwärtsging und wir ergebnistechnisch besser wurden”, resümierte Kauczinski, schob aber direkt hinterher: “Ich glaube, dass noch viele Dinge besser gehen und wir die Zeit noch mehr nutzen können, um besser zu werden.” Dafür hat er in Belek nun die perfekten Bedingungen. Kein Schnee, keine Kälte, so wie in Giesing dieser Tage.
Ich glaube, dass noch viele Dinge besser gehen und wir die Zeit noch mehr nutzen können, um besser zu werden.
TSV 1860 bereitet sich bei Top-Konditionen auf die Rückrunde vor
Dafür angenehme Temperaturen und ein Trainingsplatz in Top-Konditionen. Ackern mit nigelnagelneuen Trainingsgeräten und vor Palmen. Löwen-Herz, was willst du mehr? “Man hat gleich gespürt, dass das etwas anderes ist”, betonte Kauczinski. Das merkte man auch seinen Spielern bei der ersten Einheit am Samstagabend an. Unter den Augen von Präsident Gernot Mang, der schon am Freitag angereist war, wurde reichlich gelacht. Geschwitzt werden musste noch nicht.
Es stand ein lockeres Aufwärmen auf dem Programm. Überraschend nicht mit dabei: Siemen Voet. Der Innenverteidiger musste, wie Nachwuchskeeper Paul Bachman, das Trainingslager kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Sollte Voet bis Mitte der Woche wieder auf die Beine kommen, könnte er allerdings noch nachreisen. Ansonsten wird er in München bleiben und sich unter anderem wie Florian Niederlechner erstmal individuell auf den Rückrundenstart vorbereiten.
© sampics
von sampics
“}”>
Kauczinski legt in Belek den Fokus auf das Pressingverhalten
Derweil wird in Belek in den kommenden Tagen das Pensum nach oben geschraubt. Es bleibt freilich nicht bei ein paar Passübungen und einem Rondo. “Es wird eine Mischung aus allem”, kündigte Kauczinski an. Den Fokus will er auf das Pressingverhalten legen. In diesem Bereich sieht er noch am meisten Verbesserungspotenzial, wie der Trainer des TSV 1860 auf AZ-Nachfrage erklärte: “Das habe ich auf dem Zettel, dass wir da ein anderes Gesicht zeigen. Wir müssen einfach aktiver und mutiger sein.”
Wir müssen einfach aktiver und mutiger sein.
Das gilt auch für das Agieren mit dem Ball. Umschaltmomente, Standardsituationen und das Spiel in die Tiefe stehen auf Kauczinskis Liste. Eine Systemumstellung plant der gebürtige Gelsenkirchner in der Winterpause allerdings nicht. Das hat einen einfachen Grund, wie er erklärt: “Wenn ich zum Beispiel mit Viererkette wieder spielen lasse, hätte ich überproportional viele Abwehrspieler.”

© sampics
von sampics
“}”>
Rückkehrer um Verlaat sollen in Belek nicht verheizt werden
Vor allem, weil ihm Kapitän Jesper Verlaat und Raphael Schifferl nun wieder zur Verfügung stehen. Wie lange es allerdings braucht, bis das Verteidiger-Duo wieder bei 100 Prozent ist, kann der Übungsleiter nicht vorhersagen. Klar ist: Verheizen will er seine Rückkehrer, zu denen auch Morris Schröter und Kevin Volland gehören, im Trainingslager nicht.
Belastungssteuerung lautet das magische Wort, das für sie gilt. Mindestens am Mittwochnachmittag haben alle vier Löwen, wie der gesamte Kader, frei. Übrigens: Auf Teambuilding verzichtet Kauczinski. Dafür plant er Teamsitzungen am Abend, auf denen sich der TSV 1860 auf die Rückrunde einschwören will. “Wir werden schon die Dinge besprechen, was wir gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben, wo wollen wir hin und was nehmen sich die Jungs für das letzte halbe Jahr vor.”