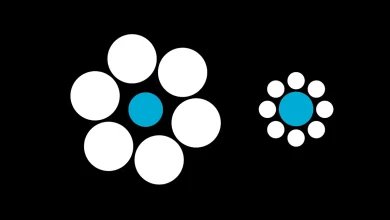Finanzfachmann Ulrich Stephan: „Ich habe für Anleger fünf Tipps“ | ABC-Z

Herr Stephan, viele Menschen sind im Moment über die unsichere Weltlage beunruhigt. Was macht man in solchen Zeiten am besten mit seinem Geld?
Ich glaube – und dazu hat der Internationale Währungsfonds gerade gute Belege geliefert –, dass die Unsicherheit im gesellschaftlichen Diskurs sehr hoch ist. Wenn man dagegen Daten für die Unsicherheit an den Finanzmärkten nimmt, ist diese gar nicht so erschreckend. Ein wirtschaftlicher Abschwung scheint global möglich, aber keine Rezession. Die gefühlte Unsicherheit ist größer als die tatsächliche, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht. Für das Geld gilt: Je nach eigener Risikoneigung breit über die Anlageklassen streuen – und dann Ruhe bewahren. Das gilt für diese Zeiten genauso wie für alle anderen.
Ist die Stimmung an den Börsen zu positiv, wenn man sich manche düsteren Konjunkturprognosen anschaut?
Man kann darüber diskutieren, ob die Börsen zu weit gelaufen sind, ob es womöglich eine Blase gibt. Diese Diskussion gibt es; ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber die Unternehmen liefern eben auch, was die Gewinne angeht. Meine Beobachtung ist, dass wir optimistisch ins Jahr gestartet sind. Die meisten Ökonomen hatten in ihrem Jahresausblick für 2025 ganz ordentliche Wachstumszahlen und haben diese dann mit Blick auf die Einführung von Zöllen durch die amerikanische Regierung nach unten revidiert. Sie fangen jetzt aber langsam wieder an, nach oben zu gehen. Wir jedenfalls gehen nicht von einer Rezession aus, wir gehen sogar für 2026 von einem beschleunigten Wachstum in Europa und in Deutschland aus, aufgrund der Fiskalprogramme. Und wie gesagt: Die Gewinnsituation ist ordentlich. Die Unternehmen haben im zweiten Quartal geliefert. Ich gehe davon aus, dass jetzt mit der höheren Planungssicherheit – wir haben zwar höhere Zölle, wissen aber, worauf man sich einstellen muss – die Unternehmen auch fürs dritte Quartal gute Zahlen liefern werden.
Warum gibt es gerade in Deutschland wenig Wirtschaftswachstum, aber trotzdem gute Gewinne der Unternehmen?
In Deutschland haben wir jetzt zwei, drei Jahre kaum Wachstum gesehen, und trotzdem sind die Kurse stark gestiegen. Die Dax-Gewinne werden zu 84 Prozent im Ausland erwirtschaftet, und ich würde sagen: Daran liegt das ganz überwiegend. Deutschland ist eine der offensten Volkswirtschaften in aller Welt, und die Unternehmen haben sich auf die Situation eingestellt, sowohl bei der Beschaffung als auch beim Absatz. Deshalb können sie mit der Lage in Deutschland selbst gut umgehen.
Ja, wenn die Unternehmen ihre Gewinne nicht liefern. Aber ich kann bislang nicht erkennen, warum das so sein sollte. Fürs zweite Quartal beispielsweise waren 14 Prozent Gewinnzuwachs von den sieben großen Technologieunternehmen, den „Magnificent Seven“, erwartet worden; die Unternehmen haben dann 27 Prozent geliefert. Der S&P 500 insgesamt brachte 14 Prozent, ohne die „Magnificent Seven“ acht Prozent. Jetzt werden von den Analysten im Konsens für das dritte und vierte Quartal jeweils 15 Prozent Gewinnplus erwartet. Ich gehe davon aus, dass die Unternehmen das wieder übertreffen werden. Der Hintergrund ist, dass schon Milliardenbeträge für Investitionen in die Künstliche Intelligenz angekündigt waren und in der Berichtssaison weitere angekündigt wurden. Ich glaube: Wer da nicht mitmacht, fällt zurück, und das Risiko ist für die Unternehmen einfach zu groß. Es gibt ja nicht nur den Wettbewerb innerhalb der Vereinigten Staaten, sondern auch den zu China. Kann sein, dass wir da irgendwann überinvestiert sind. Aber für die nächsten Jahre sehe ich das nicht. Von der Entwicklung her sind wir beim KI-Boom eher am Anfang als am Ende.
Es gibt Ökonomen, die sehen Parallelen zur Dotcom-Blase der 2000-er Jahre, weil die Bewertungen vieler KI-Aktien hoch seien. Man könne noch nicht so genau absehen, was sich in Zukunft an Technik durchsetzen werde. Das lasse viel Spielraum für Spekulation. Ist das alles Quatsch?
„Quatsch“ sagen würde ich nicht, weil ich mir grundsätzlich immer Argumente anhöre. Ich glaube aber, dass die Investitionen in die Künstliche Intelligenz tatsächlich stattfinden werden, dass wir bei der Entwicklung erst ganz am Anfang sind und nicht am Ende. Das alles wird die Wirtschaft und die Gesellschaft stark verändern. Und man darf nicht vergessen: In der Dotcom-Blase haben viele Unternehmen keine Gewinne geschrieben und waren nur hoch bewertet. Jetzt haben wir Unternehmen, die extreme Gewinne schreiben. Und ich sehe nicht, warum das morgen aufhören sollte.
Das war sicherlich der Reflex, als man ganz am Anfang des Jahres gesagt hat, dass diese Zölle kommen, und diskutiert hat, wie sie wen treffen könnten. Im Moment sind es wahrscheinlich ganz überwiegend die amerikanischen Importeure, die die Zölle tragen und sie dann irgendwann an die amerikanischen Konsumenten weitergeben. Seit dem „Liberation Day“ Anfang April laufen amerikanische Technologiewerte eben wieder, weil man sehr stark auf die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz schaut und die Gewinne weitgehend zollfrei bleiben. Von daher würde ich ein gesundes Mittelmaß wählen und nicht „Entweder-oder“ sagen. Ich würde Banken und Industrieunternehmen – also das, was die Investitionen in Infrastruktur und so weiter in Europa unterstützt – sehr intensiv anschauen. Und auf der amerikanischen Seite eben in die Technologie investieren.
Können Trumps Zölle noch für heftigere Kursschwankungen am Aktienmarkt sorgen?
Das glaube ich nicht. Ich denke zwar nicht, dass die amerikanische Administration jetzt völlig aufhört mit neuen Zöllen. Wir haben das zuletzt wieder bei Pharma erlebt. Es wurde auch über elektronische Produkte, in denen Chips verarbeitet sind, gesprochen. Man hat einfach gesehen, dass man darüber Einnahmen erzielen kann. Die Vereinigten Staaten haben ein Haushaltsdefizit von rund 1,6 Billionen Dollar und Staatsschulden von etwa 36 Billionen Dollar. „The one big beautiful bill“ wird nicht dazu führen, dass die Staatsschulden abgebaut werden, obwohl man auch Einsparungen darin hat. Insofern ist man auf Zölle und die Einnahmen daraus angewiesen. Und das scheint ja auch irgendwie zu funktionieren, wenn man mal davon absieht, wer es am Ende zahlt. Aber der Markt glaubt eben an diese „TACO“-Trades, also dass Präsident Donald Trump zurückzieht, wenn der Zins zu hoch Richtung viereinhalb Prozent geht, wenn der Dollar zu schnell zu schwach wird, wenn die Aktienmärkte dann doch betroffen sind. Wir haben zuletzt gesehen, dass Pharmaaktien wieder gut performt haben, weil Gerüchte aufkamen, dass die Zölle drei Jahre ausgesetzt werden, wenn man in den USA investiert. Die amerikanischen Pharmaunternehmen haben gesagt: Wir haben auch Produktionsstätten im Ausland, und dann werden die Amerikaner nicht mehr so gut versorgt. Als es den Einzelhandel betraf, vor allem mit den hohen Zöllen auf chinesische Produkte, sind die Einzelhändler im Weißen Haus vorstellig geworden und haben gesagt: Dann gibt es keine Weihnachtsgeschenke. Im nächsten Jahr feiern die Vereinigten Staaten 250-Jahr-Jubiläum, und es sind Wahlen, Midterm Elections. Und ich glaube nicht, dass man dann ohne Medikamente und Weihnachtsgeschenke dastehen möchte.
Zuletzt ließ das Eindringen russischer Drohnen in den NATO-Luftraum den Krieg auf einmal näher zu uns kommen. Wie geht man als Privatanleger mit solchen Risiken um?
Es ist ökonomisch schwierig zu greifen, was da wirklich geschieht. Wir wissen ja immer noch nicht genau, wer wie wo was ausgespäht hat; Drohnen über Dänemark, Norddeutschland, über Polen. Wenn ich mir den Ukrainekrieg angucke, hat er bisher wenig Auswirkungen auf unsere Börsen. Ganz am Anfang gab es Folgen für bestimmte Rohstoffe, aber insgesamt hat er wenig Einfluss auf die hiesigen Finanzmärkte gehabt. Und ich glaube, dass diese Entwicklung jetzt auch erst einmal beobachtet wird. Mein Eindruck ist, dass der Markt eher an die Abschreckung der NATO glaubt und nicht davon ausgeht, dass NATO-Gebiet in irgendeiner Weise angegriffen wird. Aber ja, man muss im Hinterkopf haben, dass Dinge auch anders laufen können. Wer davor Angst hat, muss aus dem Risiko rausgehen. Und wer sagt: Das ist für mich nicht wirklich greifbar, der wird anlagetechnisch gar nicht reagieren. Es kommt letztlich auf die Risikopräferenz an.
Eine Sache, an die man dabei denken könnte, ist Gold. Der Goldpreis ist in diesem Jahr schon sehr stark gestiegen. Denken Sie, das geht so weiter, oder ist da irgendwann mal Schluss?
Irgendwann ist immer Schluss. Aber wir haben die Situation, dass Gold offenbar als sehr sicherer Hafen angesehen wird. Nicht nur von Privatanlegern, auch von vielen institutionellen Anlegern. Die kaufen. Das Zweite ist, dass über die fallenden Zinsen die Opportunitätskosten für die Goldhaltung sinken. Und vor allem kaufen auch die Notenbanken. Sie halten mittlerweile fast 40.000 Tonnen Gold. Sie diversifizieren offenbar: Denn man sieht, dass der Dollar in den Währungsreserven runter tickert, zuletzt auf 58 Prozent global. Das sind jedes Jahr ein bis anderthalb Prozentpunkte weniger. Man sieht aber keine andere Währung, die stark zulegt; abgesehen von Gold, das mittlerweile die zweitwichtigste Reserve der Welt ist. Vor dem Hintergrund kann man einen Goldpreis von 4000 Dollar je Feinunze nicht ausschließen.
Rüstungsaktien haben sich zuletzt gut entwickelt. Ist es schon zu spät für Privatanleger, da noch einzusteigen?
Die Aktien sind schon gut gelaufen und können sich mit den „Magnificent Seven“ vergleichen. Jetzt ist aber Tatsache, dass die Europäische Union einige Erleichterungen geschaffen hat: Rüstungsausgaben werden beispielsweise nicht mehr auf die Schulden angerechnet. Man hat auch eigene Verteidigungsprogramme. Das NATO-Ziel ist, 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben. Das sind immerhin mehr als 630 Milliarden Euro je Jahr. Ich glaube, als Anleger sollte man nicht nur auf die wenigen bekannten Titel schauen, sondern diversifizieren und sich die ganze Wertschöpfungskette ansehen. Man kann auch in Anbieter von Drohnen, Satelliten oder Aufklärung investieren. Da bestehen durchaus Chancen.
Im nächsten Jahr dürften die Staatsausgaben und Staatsschulden in Deutschland deutlich zunehmen. Ist das gut oder schlecht für Privatanleger, die auf Staatsanleihen setzen?
Die Staatsschulden Deutschlands werden vermutlich von gut 60 auf gut 70 Prozent steigen. Wir sind als Deutsche sehr kritisch, was Schulden angeht. Ich versuche immer zu sagen: Schulden sind nicht per se ein Problem, sondern nur, wenn man das Geld falsch ausgibt. Ich würde der Bundesregierung zunächst zutrauen, dass sie das schon vernünftig macht, auch wenn es vielleicht nicht so schnell geht, wie wir uns das wünschen würden. Von daher glaube ich, dass die Schuldenstandsquote nicht viel steigen wird und dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von jetzt 2,7 Prozent sich in den nächsten zwölf Monaten eher seitwärts entwickeln wird. Da stecken schon alle Informationen drin. Ich sehe nicht, warum sie weiter steigen sollte.
Hätten Sie vielleicht einen Tipp, welche wenig beachteten Anlageobjekte noch für Privatanleger interessant sein könnten?
Ich hätte sogar fünf Ideen. Erstens: Pharmaaktien. Wir haben gesehen, dass die Kurse in diesem Jahr sehr stark zurückgelaufen sind. Ich halte das für übertrieben. Die Gewinne steigen dort um zweistellige Prozentsätze. Zweitens: die ganze Wertschöpfungskette rund um die Künstliche Intelligenz. Ich würde nicht nur auf die Hyperscaler und die Hersteller von Chips schauen, die sicherlich im Zentrum dieser Entwicklung stehen. Es geht darüber hinaus auch um klimaneutrale Stromerzeugung, um Leitungen, Betreiber von Rechenzentren und um Immobilien für Rechenzentren. Drittens: der diskretionäre Konsum in Europa – die Markenhersteller und die Autobranche. Diese Aktien haben jetzt zwei Jahre überhaupt nicht performt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Richtung 2026 eine gewisse Erholung gibt. Viertens: Aktien aus Osteuropa. Wenn in Deutschland die Infrastruktur gemacht wird, profitieren polnische Unternehmen ganz besonders. Polens Exporte hängen praktisch eins zu eins am deutschen Bruttoinlandsprodukt. Und fünftens: amerikanische Small- und Mid Caps, die relativ stark verschuldet sind und deshalb von sinkenden Zinsen profitieren dürften.
Der Anlagefachmann
Ulrich Stephan, 59 Jahre alt, ist Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden in Deutschland der Deutschen Bank. Seine berufliche Laufbahn in der Bank begann er 1995 als Trainee. Nach Stationen in Viersen, Düsseldorf und Sydney ist Stephan seit 2001 in Frankfurt tätig. Er hatte verschiedene Funktionen, denen gemeinsam ist, dass sie einen Bezug zu den Finanzmärkten haben. Studiert hat er Volks- und Betriebswirtschaftslehre in Köln mit den Abschlüssen Diplom-Volkswirt und Diplom-Kaufmann. 1997 wurde er dort promoviert. Internationale Erfahrung sammelte er unter anderem während eines Studienaufenthalts an der Sloan School of Management des Massachusetts Institute of Technology. In der Bank steht er in dem Ruf, Anlagethemen für Verbraucher anschaulich vermitteln zu können.