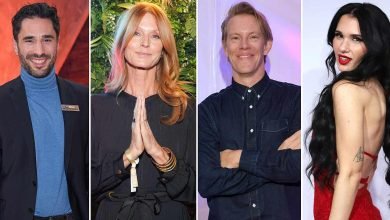Collien Fernandes unangeschlossen: Was hinter dem Ehe-Aus mit Christian Ulmen steckt | ABC-Z

Hübsch, ein bisschen vorlaut, aber nie um einen guten Spruch verlegen: Collien Ulmen-Fernandes steht bereits die Hälfte ihres Lebens (20 Jahre) vor der Kamera. Wie tickt die Moderatorin, Schauspielerin und Autorin privat?
Früher Karriere-Start: Collien Ulmen-Fernandes zog mit 15 Zuhause aus
Bereits in ihrer Jugend suchte Collien Ulmen-Fernandes das Rampenlicht. Mit 15 Jahren begann sie ihre Karriere als Model und Tänzerin, wofür sie sogar aus ihrem Elternhaus auszog. Sie stand als Vorführdame für Werbefilme und Versandhäuser vor der Kamera, absolvierte eine klassische Ballettausbildung und war als Background-Tänzerin für Superstar Enrique Iglesias im Einsatz.
2000 wurde sie bei einem Casting als Moderatorin entdeckt und zeigte ihre Talente als Quasselstrippe unter anderem in Musikshows wie “Bravo TV”, “Interaktiv”, “The Dome” und “Ritmo”. Von 2003 bis 2015 war sie für den Musiksender Viva tätig. Auch als Schauspielerin hat sie sich einen Namen gemacht und spielte in Kinofilmen wie “Autobahnraser”, “Die Nacht der lebenden Loser” und “Morgen, ihr Luschen!”.
Collien Ulmen-Fernandes privat: Moderatorin und Christian Ulmen geben Trennung bekannt
2018 heiratete Ulmen-Fernandes den Schauspieler Christian Ulmen. Die beiden standen auch gemeinsam vor der Kamera, denn in der Serie “Jerks” tritt die 43-Jährige als fiktive Ex-Partnerin von Christian Ulmen auf. Was in “Jerks” noch fiktiv war, wurde jetzt Realität. Wie am 4. September 2025 bekannt wurde, ist die Liebe zwischen Collien Ulmen-Fernandes und dem TV-Star erloschen. “Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben”, heißt es in einem Statement, das “Bild” vorliegt.
Haben Collien Ulmen-Fernandes und Ex Christian Ulmen gemeinsame Kinder?
Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen haben eine gemeinsame Tochter, die 2012 auf die Welt kam. Im “Bild”-Statement zur Trennung heißt es im Weiteren: “Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen.”
© imago/Vistapress
von imago/Vistapress
“}”>
Warum zeigt Collien Ulmen-Fernandes ihre Tochter nicht öffentlich?
Bislang gab es auf Instagram keine Bilder von Collien Ulmen-Fernandes’ Kind. Das hat auch einen Grund, wie die Moderatorin 2020 in einem Interview mit “Bunte” erklärte: “Ich habe seit Jahren einen Stalker. Und ich habe einfach Angst, dass er mein Kind entführt.”
Vermögen von Collien Ulmen-Fernandes: So hat sie ihr Geld angelegt
Wenn es um Geld geht, hat die Moderatorin und Schauspielerin kein Problem damit, offen darüber zu sprechen. Mit Mitte 20 habe sie ausgesorgt gehabt und auch nicht mehr arbeiten müssen, verriet sie 2020 dem “Spiegel”.
Im Gespräch mit “Freundin” verriet Collien auch, wie sie ihr Geld angelegt hat: “Ich habe das Geld nicht groß in Luxus gesteckt, sondern ganz früh an meine Rente gedacht und fürs Alter vorgesorgt. Daher habe ich mein Geld schon immer in Immobilien gesteckt, weil ich dadurch schon früh sichere Einnahmen durch die Miete hatte.” Grund für ihre Sparsamkeit seien auch ihre schwäbischen und indischen Wurzeln.