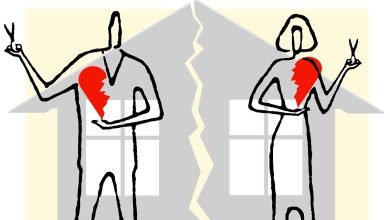EHEC steht für enterohämorrhagische Escherichia coli. Es handelt sich um eine Sonderform der Kolibakterien, die im Darm Nährstoffe spalten und für die Abwehr von Krankheitserregern sorgen. EHEC sind Bakterien, die normalerweise im Darm von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen, Ziegen oder Rehen vorkommen. Sie produzieren sogenannte Shigatoxine: starke Zellgifte, die bei Menschen schwere Durchfallerkrankungen sowie das sogenannte hämolytisch-urämische Syndrom (HUS) verursachen können.
In leichten Fällen spüren Menschen, die sich mit EHEC-Bakterien infiziert haben, unter Umständen keine Symptome, sodass die Infektionen unerkannt bleiben können. In den meisten Fällen zeigt sich eine EHEC-Infektion aber in Form eines wässrigen Durchfalls. Hinzu kommen können Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen.
In besonders schweren Fällen kann es zu blutigem Durchfall und Fieber kommen verbunden mit Komplikationen wie dem hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS). Bei einem HUS können Betroffene unter Blutarmut, Blutgerinnungsstörungen, neurologischen Ausfällen wie Verwirrtheit und Krampfanfällen bis hin zu Herzproblemen und Nierenversagen leiden. Die Erkrankung kann lebensbedrohliche Ausmaße annehmen.
Kommt es zu einem hämolytisch-urämischen Syndrom, sind vor allem Kleinkinder gefährdet. Ihr Immunsystem und ihre Organe sind noch nicht ausgereift, sodass das Risiko für ein Nierenversagen höher ist. Tritt dieser Fall ein, müssen betroffene Kinder vorübergehend eine Dialysebehandlung bekommen. Dabei wird Blut außerhalb des Körpers gereinigt, weil die Nieren dazu nicht mehr in der Lage sind. Auch bei älteren und immunsupprimierten (körpereigenes Abwehrsystem unterdrückt) Menschen kann ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf bestehen.
Vom Verzehr eines verunreinigten Lebensmittels bis zum Ausbruch der Erkrankung dauert es laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Durchschnitt drei bis vier Tage. Die Inkubationszeit kann aber zwischen zwei und zehn Tagen variieren.
Zunächst sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen. Das gilt vor allem dann, wenn sich bei Patienten blutiger Durchfall zeigt. Der Nachweis einer EHEC-Infektion ist im Labor möglich. Erkrankte sollten nicht mit einem Antibiotikum behandelt werden, weil dies die Situation verschlimmern kann. Zum einen würden die Patienten dadurch länger EHEC-Erreger ausscheiden und wären dadurch für ihr Umfeld ein größeres Ansteckungsrisiko. Durch den Einsatz eines Antibiotikums müsste aber vor allem mit einer verstärkten Freisetzung der Giftstoffe aus den Bakterien gerechnet werden, was zu einem schweren Krankheitsverlauf führen könnte.
Die EHEC-Bakterien werden in der Regel über den Kot von Tieren verbreitet. Schon sehr geringe Mengen mit weniger als 100 Erregern können beim Menschen zu einer Infektion führen. Dazu kann es beim direkten Kontakt mit Tieren kommen. Aber auch eine indirekte Infektion über den Verzehr von Rohmilchprodukten, Hackfleisch und Rohwurstsorten oder von Obst und Gemüse ist möglich. Beim Baden in mit Fäkalien verunreinigtem Wasser können Menschen den gefährlichen Erreger ebenfalls aufnehmen. Auch die Übertragung von Mensch zu Mensch ist möglich – in Form sogenannter Schmierinfektionen.
Ein wichtiger Schutz vor EHEC-Erregern ist strenge Hygiene. Am besten ist es, sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen, besonders nach dem Toilettengang und vor dem Zubereiten von Essen. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt zudem, Speisen gründlich zu garen, mindestens zehn Minuten lang bei 70 Grad oder einer höheren Temperatur. Frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse sollten gründlich gewaschen, leicht verderbliche Lebensmittel immer im Kühlschrank aufbewahrt werden. Zusätzlich wird empfohlen, bei der Zubereitung von Fleisch und anderen Lebensmitteln nie dieselben Messer oder Schneidebretter zu verwenden. Nach dem direkten Kontakt mit lebenden Tieren – zum Beispiel in einem Streichelzoo – ist es wichtig, sich gründlich die Hände zu waschen. Ist im direkten Umfeld jemand infiziert, sollten Gegenstände, die der Erkrankte berührt hat, sowie Kleidungsstücke desinfiziert werden. Der Kontakt mit Erkrankten sollte minimiert werden.
Die Quelle der aktuellen Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist noch nicht identifiziert. Jedoch ist es im Nationalen Referenzzentrum (NRZ) in Wernigerode inzwischen gelungen, den Ausbruchsstamm des Bakteriums zu identifizieren. Er gehört demnach zum Subtyp O45:H2, der in Deutschland nur selten vorkommt. Die Bestimmung kann zum einen bei der Suche nach der Quelle des aktuellen Ausbruchs helfen. Zum anderen kann nun zugeordnet werden, welche der aktuellen Fälle mit dem Ausbruch in Verbindung stehen – und welche Fälle dem jahrestypischen Auftreten von EHEC zuzuordnen sind.
EHEC-Ansteckungen gibt es regelmäßig. Laut Robert Koch-Institut wurden 2023 bundesweit mehr als 3.440 Erkrankungen erfasst, 2024 rund 4.570 und in diesem Jahr bisher etwa 3.660 (Stand 27. August). Im Jahr 2023 waren fünf, im Jahr darauf drei HUS-bedingte Todesfälle gemeldet worden. In Mecklenburg-Vorpommern wurden im Jahr 2024 mehr als 130 Fälle erfasst, im Jahr davor 80. Im aktuellen Fall ist die Aufmerksamkeit auch deshalb hoch, weil so viele Kinder in recht kurzer Zeit von betroffen sind.
Den bislang schwersten Ausbruch von EHEC-Infektionen in Deutschland gab es im Jahr 2011. Damals wurden 3.842 Erkrankungen registriert, 53 Menschen starben. Als wahrscheinliche Ursache für den Ausbruch von 2011 gelten verunreinigte Sprossen importierter Bockshornkleesamen aus Ägypten.