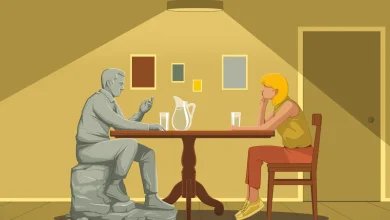Studie: Hitzewellen aufgrund des Klimawandels 1,4 Grad heißer – Wissen | ABC-Z

Der menschengemachte Klimawandel hat die Hitzewellen der Jahre 2000 bis 2023 erheblich wahrscheinlicher und intensiver gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie einer Gruppe um Yann Quilcaille von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. „Unsere Analyse zeigt, dass der menschengemachte Klimawandel bei allen 213 hier analysierten Hitzewellen zu einer Zunahme der Intensität beigetragen hat“, schreibt das Team.
Die Forscher identifizierten zunächst mithilfe der internationalen Katastrophendatenbank EM-DAT insgesamt 213 Hitzewellen, die zwischen 2000 und 2023 in 63 Ländern auftraten und dokumentierte Schäden verursachten. Anschließend wendeten sie Methoden der Attributionsforschung an, um den spezifischen Anteil des Klimawandels an der Intensität jedes einzelnen Ereignisses zu bestimmen.
Laut der im Fachmagazin Nature erschienenen Studie sind Hitzewellen aufgrund der globalen Erwärmung zwischen 2000 und 2009 um das Zwanzigfache und im Zeitraum 2010 bis 2019 um das Zweihundertfache wahrscheinlicher geworden, jeweils verglichen mit dem vorindustriellen Zeitraum. Eine Hitzewelle, die Anfang des 21. Jahrhunderts auftrat, war demnach im Schnitt etwa 1,4 Grad heißer als eine vorindustrielle Hitzeperiode.
Die Studie belege, dass der Einfluss des Klimawandels seit dem Jahr 2000 deutlich zugenommen habe, sagt der Klimaforscher Douglas Maraun von der Universität Graz, der nicht an der Studie beteiligt war. Diese Intensivierung zeige, „dass der Klimawandel mittlerweile so stark ist, dass er sich deutlich in den meisten Hitzewellen zeigt.“
Zugleich müssten die Ergebnisse von Attributionsstudien sorgfältig eingeordnet werden. „Wenn eine Studie findet, dass beispielsweise eine Hitzewelle von 45 Grad durch den Klimawandel drei Grad heißer beziehungsweise 100-mal wahrscheinlicher geworden ist, bedeutet dies, dass diese Hitzewelle erstens ohne den Klimawandel drei Grad kälter, also 42 Grad heiß gewesen wäre, und zweitens die Überschreitung der gemessenen Temperatur 100-mal wahrscheinlicher wurde“, sagt Maraun. Es bedeute also nicht, dass es ohne den Klimawandel gar keine Hitzewelle gegeben hätte, „sondern, dass diese deutlich schwächer ausgeprägt gewesen wäre“.
„Wir sehen überall auf der Welt, dass Temperaturrekorde gebrochen werden, und das impliziert neue Temperaturmaxima, die ohne Klimawandel extrem unwahrscheinlich wären“, sagt Holger Kantz vom Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden. Allerdings überspitzen die Autoren um Quilcaille seiner Auffassung nach etwas, wenn sie wiederholt davon sprechen, der Klimawandel habe einzelne Hitzewellen „10 000 Mal wahrscheinlicher“ gemacht. Bei den meisten Hitzewellen sei „eine Zunahme der Wahrscheinlichkeit um einen Faktor 1,1 bis 10“ zu beobachten, so Kantz.
Das Team um Quilcaille berechnete auch, welchen Anteil einzelne Treibhausgas-Verursacher an den Hitzewellen haben. Dabei handelt es sich um 180 private und staatliche Unternehmen, hauptsächlich Produzenten von Erdöl, Kohle und Zement, sowie einzelne Staaten.
Die Berechnungen ergaben, dass die 180 größten Verursacher von Kohlendioxid und Methan für rund 57 Prozent des menschengemachten Treibhausgasausstoßes verantwortlich sind. Allein 14 von ihnen sorgten im Zeitraum von 1854 bis 2023 für 30 Prozent der klimaschädlichen Emissionen. Dazu zählt das Team unter anderem die frühere Sowjetunion, China jeweils einzeln für Kohle und für Zement, Indien für Kohle, sowie die Ölkonzerne Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil, die National Iranian Oil Company, BP und Shell.
„Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir die schwerwiegenden Folgen extremer Wetterereignisse für die Wirtschaft und Gesellschaft der Welt erkennen – hitzebedingte Todesfälle, Ernteausfälle und vieles mehr“, wird Quilcaille in einer Mitteilung zitiert. Die Menschen machten sich Gedanken darüber, wer in welcher Weise zu den Katastrophen beigetragen habe.
Die Studie sei „ein wichtiger Schritt in Richtung Verantwortlichkeit“, sagt Friederike Otto vom Imperial College London. Gefährliche Wetterveränderungen könnten zunehmend mit den Emissionen einzelner fossiler Konzerne verknüpft werden. Viele der Unternehmen hätten bereits in den 1970er-Jahren gewusst, dass die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Erwärmung des Planeten beiträgt, so Otto. „Anstatt ihre Geschäftsmodelle auf erneuerbare Energien umzustellen, haben sie die Öffentlichkeit über die Gefahren ihrer Produkte getäuscht und sich bei Regierungen dafür eingesetzt, dass die Welt weiterhin von fossilen Brennstoffen abhängig bleibt.“
Mit Material von dpa und vom Science Media Center