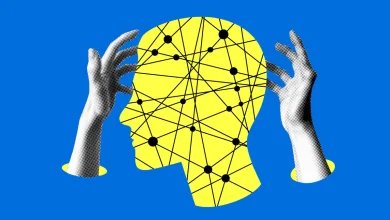Sternhimmel im Oktober: Wann Saturn und sein Ring sichtbar sind | ABC-Z

Sobald im Oktober die Abenddämmerung zu Ende geht, erscheint im Südosten der Saturn: Nach der Opposition des Planeten Ende September, während der er der Sonne genau gegenüber stand, rückt er nun an den Abendhimmel und damit in die „Primetime“ der Sternengucker, jedenfalls derer, die die zweite Nachthälfte gerne im warmen Bett verbringen. Noch vor Mitternacht erreicht Saturn seinen höchsten Stand im Süden; sein Untergang zieht sich in die Morgenstunden. Mit seiner Position zwischen den Tierkreissternbildern Wassermann und Fische erreicht er keine berauschenden Höhen, aber immerhin passable für eine Beobachtung mit Fernglas und Teleskop.
Ein Fernrohr ist das Mittel der Wahl für die Saturnbeobachtung. Seinen Ring zeigt der Planet nur bei höherer Vergrößerung. Saturn ist mit seinem Schmuck nicht allein im Sonnensystem (auch Jupiter, Uranus, Neptun sowie wenigstens vier Asteroiden besitzen Ringsysteme), aber der Einzige, der seinen Ring im kleinen Amateurteleskop zeigt. Wobei man längst weiß, dass der „Ring“ zwar wie eine einzige, feste Scheibe aussieht, sich aber in mehr als tausend Einzelringe aufspaltet. Hinzu kommen noch Teilringe, sogenannte Ringbögen, die teilweise nur mit Raumsonden aus der Nähe aufgespürt werden konnten.
Saturn umkreist die Sonne einmal alle 29,5 Erdjahre
Sie alle bestehen aus Abermillionen von Staub- und Eiskörnchen sowie größeren Gesteinsbrocken. Das ganze Ensemble entstand wahrscheinlich, als ein kleiner Mond dem Saturn zu nahe kam und durch die auf ihn ausgeübten Gezeitenkräfte zerrissen wurde. Dieser Mond muss ein Zwerg gewesen sein, die Gesamtmasse der Saturnringe entspricht einem Himmelskörper von nicht mehr als 300 Kilometer Durchmesser. Das ist jedenfalls die verbreitetste Theorie – wenn sie stimmt, sind die Ringe nicht nur sehr jung, sondern auch flüchtig. Man geht davon aus, dass sie erst vor kosmisch kurzer Zeit, 100.000 Jahren vielleicht, entstanden sind und bald auch wieder verschwinden werden, weil ihr Material auf den Saturn fällt.
In diesem Jahr sehen die Saturnringe allerdings weniger prächtig aus. Wie schon im Vormonat erwähnt, blicken wir 2025 fast genau auf die Ringkante. Die Ringe durchmessen zwar mehr als 400.000 Kilometer (und würden den Raum zwischen Erde und Mond mehr als füllen), sind teilweise aber weniger als 100 Meter dick. Saturn umkreist die Sonne einmal alle 29,5 Erdjahre, und da seine Ringe um etwa 27 Grad gegenüber seiner Umlaufbahn geneigt sind, verändert sich unser Blick auf sie, während sowohl Saturn als auch die Erde die Sonne umkreisen.
Zweimal pro Saturnjahr blicken wir auf die dünne Ringkante. Zuletzt war das am 23. März der Fall, leider stand Saturn da unbeobachtbar hinter der Sonne am Taghimmel. Anfang Oktober beträgt der Ringöffnungswinkel immer noch nur 1,5 Grad, wobei wir leicht auf Saturns Südhalbkugel blicken. Bis Ende November wird er sich sogar wieder bis auf 0,3 Grad verkleinern. Erst danach beginnt sich unser Blick auf Saturns Ringe wieder zu verbessern, bis 2032, wenn der maximale Öffnungswinkel erreicht ist.
Außer Saturn zeigt sich der Abendhimmel im Oktober planetenfrei – und auf Herbst eingestellt: Die Herbststernbilder sind weniger markant als die des Sommers und des Winters; am ehesten fällt das Viereck aus den eher schwachen Sternen auf, das sich auf unserer Karte hoch im Südosten, direkt nördlich von Saturn, finden lässt. Es setzt sich aus Sternen des Pegasus und der Andromeda zusammen (die linke obere Ecke gehört zur Sternenprinzessin); zu seiner Rechten, also Richtung Westen, stehen noch die hellen Sommersterne Altair, Deneb und Wega. Dicht über dem Nordosthorizont sind mit Kapella im Fuhrmann und Aldebaran im Stier schon zwei Protagonisten des Winterhimmels zu sehen.
Auch der Sternhaufen der Plejaden, des Siebengestirns, ebenfalls zum Stier gehörig, ist schon aufgegangen. Zwei weitere helle Herbststerne finden wir dicht über dem Süd- beziehungsweise Südosthorizont: Fomalhaut im Sternbild Südlicher Fisch ist einer der hellsten Sterne des Himmels, der Wega in der Leier nicht unähnlich, in unseren Breiten aber wegen seiner südlichen Position kaum bekannt. Deneb Kaitos, auch bekannt als Beta Ceti, im Sternbild Walfisch ist weniger hell als Fomalhaut, der rote Riesenstern übertrifft aber den Alphastern seiner Konstellation, Menkar (auf der Karte genau über dem Osthorizont). Auch er wird wegen seiner tiefen Position oft übersehen. In diesem Jahr hilft Saturn bei der Suche nach den beiden: Fomalhaut, Deneb Kaitos und der Ringplanet bilden ein weites Dreieck über dem südlichen Horizont.
Wer weitere Planeten sehen will, muss bis zur zweiten Nachthälfte oder auf den Morgen warten. Jupiter, direkt südlich der hellen Sterne Kastor und Pollux in den Zwillingen, erscheint zum Monatsende vor Mitternacht am Osthorizont; Venus ist weiterhin heller „Morgenstern“, wenngleich ihre Sichtbarkeitsperiode langsam zu Ende geht. Wenn alles gut läuft, könnten sich zwei Schweifsterne am Abendhimmel zeigen: Der Komet C/2025 R2 SWAN wird um den 20. Oktober im Sternbild Schild, südlich des Adler, die Erde passieren. C/2025 A6 Lemmon wird Ende Oktober nach Ende der Dämmerung die Sternbilder Bärenhüter, Schlange und Schlangenträger durchlaufen. Optimistische Schätzungen behaupten, dass man beide mit einem Fernglas sehen können wird. Für das bloße Auge wird es wohl gerade nicht reichen.
Sonne: 1. Oktober, Sonnenaufgang 7.26 Uhr, Sonnenuntergang 19.03 Uhr; 31. Oktober, Sonnenaufgang 7.14 Uhr, Sonnenuntergang 17.03 Uhr.
Mond: 7. Oktober, 5.48 Uhr: Vollmond; 13. Oktober, 20.13 Uhr: Letztes Viertel; 21. Oktober, 14.25 Uhr: Neumond;29. Oktober, 17.21 Uhr: Erstes Viertel.