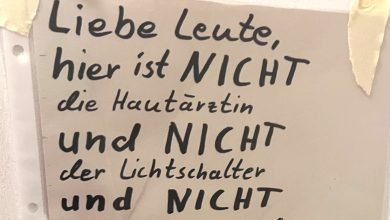Steffen Krach und Walter Momper: „Den roten Schal kenne ich, seitdem ich zehn bin“ | ABC-Z

taz: Herr Krach, als die Berliner Mauer am 9. November 1989 fiel, waren Sie gerade zehn Jahre alt. Hat Sie das in diesem Alter überhaupt interessiert, im fernen Hannover?
Steffen Krach: Das hat mich sehr interessiert, weil ein großer Teil meiner Verwandten im Osten Deutschlands gelebt hat. Meine Tante und ihre Familie wollten schon lange ausreisen. Am 2. November 1989 hatten sie ihre Ausreisegenehmigung in der Tasche.
taz: Eine Woche vor dem Mauerfall.
Krach: In der Nacht sind sie bei uns eingezogen. Zu fünft. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir ihnen eine Woche später gesagt haben, die Mauer sei gefallen. Das konnten sie nicht glauben. Wenn ich da schon etwas älter gewesen wäre, wäre ich sofort in den Zug gestiegen und nach Berlin gefahren.
Im Interview: Steffen Krach und Walter Momper
Steffen Krach ist designierter Spitzenkandidat der SPD für die Abgeordnetenhauswahl 2026. Der heute 46-Jährige war von 2014 bis 2021 Wissenschaftsstaatssekretär des Berliner Senats, aktuell ist er noch Regionspräsident in Hannover.
Walter Momper war von 1989 bis 1991 für die SPD Regierender Bürgermeister von Berlin. Es folgten mehrere erfolglose Versuche, erneut Senatschef zu werden. Von 2001 bis 2011 war der heute 80-Jährige Präsident des Abgeordnetenhauses.
taz: So mussten Sie alles vom Fernseher aus verfolgen. Wie haben Sie den Mann mit dem roten Schal, also Walter Momper, in Erinnerung?
Krach: Den roten Schal kenne ich, seitdem ich zehn bin. Walter Momper ist seitdem für mich mit dem Fall der Mauer verbunden.
taz: Herr Momper, ist das exakt derselbe rote Schal, den Sie heute mitgebracht haben?
Walter Momper: Es gibt viele rote Schals.
taz: Das Original liegt vermutlich in einer Vitrine des Deutschen Historischen Museums.
Momper: Den wollten die haben, ich habe ihn aber nicht hergegeben.
taz: Sie haben der taz einmal verraten, wie die BVG den Ansturm nach dem 9. November gemeistert hat. Sie fuhr einfach nach dem Smog-Notfallplan, also dem Plan, den sie in der Tasche hatte für den Fall eines Fahrverbots für Autos.
Momper: Allein am Wochenende nach der Maueröffnung waren eine Million Ostdeutsche in Westberlin. 300.000 davon auf dem Tauentzien zwischen Gedächtniskirche und KaDeWe.
taz: Es wurden auf die Schnelle Stadtpläne gedruckt, die Ausgabe des Begrüßungsgeldes musste organisiert werden. Hat es Sie im Nachhinein selbst überrascht, dass Berlin das hingekriegt hat?
Momper: Nein. Das war gut organisiert. Mit den Vorbereitungen haben wir ja schon nach dem 30. Oktober 1989 begonnen.
taz: Da hatten Sie die Information bekommen, dass es in der DDR in absehbarer Zeit die Reisefreiheit geben würde.
Momper: Wir wussten das von SED-Politbüromitglied Günter Schabowski, aber wir wussten nicht, wann genau. Es hieß nur, dass es noch vor Weihnachten kommen sollte. Als ersten Schritt haben wir sofort eine Urlaubssperre verhängt. Die Verwaltung war am 9. November also vorbereitet. Als das Bargeld für das Begrüßungsgeld ausging, haben die Amerikaner ein Flugzeug mit 7 Tonnen Geldscheinen geschickt.
taz: Würde Berlin auch heute noch ein Großereignis wie den Mauerfall bewältigen können?
Foto:
Sophie Kirchner
Momper: Wenn man die Verwaltung genügend motiviert, schafft man das.
taz: Das Wort, das damals überall die Runde gemacht hat, war „Wahnsinn“. Heute ist von Wahnsinn meistens dann die Rede, wenn man über das spricht, was in Berlin alles nicht funktioniert. Über den Müll auf den Straßen und ausfallende Züge der BVG. Auch über die Verwaltung. Wie wollen Sie diese Abwärtsspirale stoppen, Herr Krach?
Krach: Ich teile die Einschätzung nicht, dass sich Berlin in einer Abwärtsspirale befindet. In vielen Bereichen haben wir eine gute Entwicklung, etwa beim überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum, und wir haben auch in der Berliner Verwaltung viele motivierte Kolleginnen und Kollegen. Aber ja, es gibt Bereiche, in denen große Unzufriedenheit herrscht, wie unsere Stadt funktioniert. Um das zu verändern, reicht es nicht, nur auf Digitalisierung zu setzen. Wir brauchen wieder mehr Entscheidungsfreude und Gestaltungswillen. Und das Verständnis, dass die Verwaltung der Dienstleister für 3,8 Millionen Menschen sein muss. Die Verwaltung ist dafür da, dass die Stadt funktioniert. Das gilt auch für den Regierenden Bürgermeister.
taz: Immerhin hat der Senat gerade eine Verwaltungsreform gestemmt bekommen, mit den Stimmen von Grünen und Linken.
Krach: Es geht aber auch darum, weiter zu motivieren. Nicht zu erklären, was alles nicht geht, sondern, was geht. Jeder einzelne Mitarbeiter muss wissen, wo es Möglichkeiten gibt, Dinge umzusetzen.
taz: Dass so vieles nicht funktioniert, liegt ja nicht nur an der Verwaltung, sondern an jedem Einzelnen. Da fehlt vielen inzwischen ein Verantwortungsgefühl. Den Müll, den die BSR dann aufsammelt oder nicht, haben einzelne Menschen hinterlassen.
Krach: Da hat jede und jeder einzelne von uns Verantwortung, das ist richtig. Auch da muss es einen Wandel geben. Es darf nicht cool sein, dass man einfach seine Matratze auf die Straße wirft und darauf hofft, dass es irgendwer schon wegräumt. Wie sauber unsere Stadt ist, haben wir alle selbst in der Hand. Wir müssen insgesamt wieder rücksichtsvoller mit unserem Berlin und auch miteinander umgehen.
taz: Herr Momper, war Berlin 1989 rücksichtsvoller?
Momper: Die Rücksichtslosigkeit gab es damals nicht. Da war die Welt noch in Ordnung. Im kleinen Westberlin, aber auch im kleinen Ostberlin. Da passte jeder auf seine Umgebung auf.
taz: Würde ein Großereignis wie Olympia helfen, dass wieder mehr Menschen Verantwortung für ihre Stadt übernehmen?
Krach: Ich will ein Großereignis wie Olympia überhaupt nicht mit dem vergleichen, was 1989 passiert ist. Ich glaube aber, dass man die Menschen davon überzeugen kann, dass sich Olympia oder auch die Expo 2035 auf die einzelnen Kieze positiv auswirken. Dass es einen Mehrwert geben kann für die Infrastruktur, für den Wohnraum, für den klimagerechten Stadtumbau. Dass es sich für diese Ziele lohnt, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Das haben wir in Paris gesehen.
taz: Auch in Paris gab es kritische Stimmen.
Krach: Als die Spiele dann begonnen haben, stand die ganze Stadt hinter Olympia. Dass in Berlin das Vertrauen fehlt, dass die Spiele dem Großteil der Bevölkerung zugutekommen können, sollte dem Regierenden Bürgermeister zu denken geben. Übrigens hat auch die Expo 2000 in Hannover viel gebracht, nicht zuletzt bezahlbaren Wohnraum und einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wenn man sich richtig dahinterklemmt, kann man solche Vorhaben sehr wohl zum Nutzen der Menschen in unserer Stadt machen.
taz: Für die Expo in Hannover gab es eine Beteiligung der Bürger. So wie auch für die Bewerbung Münchens um die Olympischen Spiele. Da haben zwei Drittel zugestimmt. Berlin plant keine solche Beteiligung.
Krach: Aus der Stadtgesellschaft heraus könnte ein Volksbegehren angestrengt werden. Wenn man ein vernünftiges Bewerbungskonzept hat, könnte man da ruhig mutiger sein.
taz: Hamburg hat 2015 seine Verfassung geändert, um auch ohne Volksbegehren eine Befragung durchzuführen.
Krach: Ich bin absolut kein Fan von Markus Söder, aber natürlich hat er das sehr schlau gemacht. Natürlich hat die Münchner Bewerbung durch das klare Votum Rückenwind. Ein solches Votum würde uns auch in Berlin helfen.
taz: Vielleicht wäre es sogar die Voraussetzung, um überhaupt die Chance auf einen Zuschlag aufrechtzuerhalten? Wenn wir der DOSB wären, der über die nationale Bewerbung entscheidet, und wir wüssten, dass es vielleicht neben den zwei Dritteln in München auch in Hamburg ein positives Votum gibt, gehen wir doch nicht das Risiko ein, Berlin zu nominieren. Es wäre doch eine Blamage, wenn die deutsche Bewerbung dann von einem Berliner Volksentscheid gekippt wird.
Krach: Schon vorher müsste sich auch die Bundesregierung für die Hauptstadt aussprechen. Ich bin überrascht, dass Kai Wegner da so zurückhaltend ist und sich bei seinem Parteifreund Merz nicht mehr für Berlin einsetzt. Da gab es in Frankreich keine Diskussionen.
taz: Frankreich ist zentralistisch, Deutschland föderal.
Krach: Es gab auch in London keine Diskussion. Auch nicht in Griechenland. Da ist der Regierende Bürgermeister im Vergleich zu Markus Söder viel zu zögerlich.
taz: Anders als in München gibt es in Berlin keine Mehrheit für die Olympischen Spiele. Wäre es da nicht an der Zeit, die Bewerbung zurückzuziehen und die 6 Millionen Euro Werbungskosten zu sparen?
Krach: Wir sind eine sportbegeisterte Metropole mit fast einer Million Mitgliedern in Sportvereinen. Sie alle haben eine Familie, Freunde, Bekannte. Man kann das Feuer in Berlin entfachen, die Menschen begeistern. Aber man muss dann auch alles daransetzen, die Spiele zu bekommen, und nicht so halbherzig agieren wie Kai Wegner.
taz: Herr Momper, hat die Berliner Zurückhaltung bei Olympia auch damit zu tun, dass bei der Bewerbung für die Spiele 2000, die 1993 entschieden wurde, so ziemlich alles schiefgelaufen ist, was schiefgehen konnte? Inklusive des Erstellens von Dossiers über die sexuellen Vorlieben der IOC-Mitglieder?
Momper: Das glaube ich nicht.
taz: Die Angst vor steigenden Mieten war schon damals groß. Vielleicht ist sie jetzt sogar noch größer. Ganz egal, welche Erfahrungen Herr Krach in Hannover mit der Expo gemacht hat.
Momper: Die Verantwortlichen konnten die Befürchtungen nicht ausräumen. Aber sie konnten auch nicht beweisen, dass sie falsch waren, weil Berlin den Zuschlag nicht bekommen hat.
Foto:
Sophie Kirchner
taz: Sie sind seit 60 Jahren Mitglied der SPD. Ist Ihnen ein Stein vom Herzen gefallen, dass Ihre Partei nicht mit Raed Saleh oder Franziska Giffey ins Rennen ums Rote Rathaus geht, sondern mit Steffen Krach?
Momper: Ja, klar ist mir da ein Stein vom Herzen gefallen. Steffen Krach ist ein guter Mann. Er kennt die Stadt, bringt Regierungskompetenz aus Hannover mit und hat vorher Erfahrungen in seiner Position als Staatssekretär in der Wissenschaftsverwaltung gewonnen. Da merkt man, was schieflaufen kann und wo man ansetzt. Er ist der richtige Kandidat.
taz: Es ist erstaunlich, wie ruhig es in der Berliner SPD gerade ist. Wird das so bleiben? Schaffen Sie es tatsächlich, eine Partei, von der Ihr ehemaliger Vorsitzender Peter Strieder sagte, sie sei die größte Selbsterfahrungsgruppe Berlins, hinter sich zu vereinen?
Krach: Es hätte der SPD niemand zugetraut, dass wir so geschlossen eine Kandidatenkür hinbekommen, wo wir über Wochen und Monate Gespräche führen, die nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sind.
taz: Darüber haben wir uns auch gewundert.
Krach: Für Sie mag das jetzt traurig sein, für uns ist das sehr gut. Das ist einer der Gründe dafür, warum ich mit einem sehr guten Gefühl in die Kandidatur gehe. Seitdem die Personalie am 1. September offiziell ist, erlebe ich eine unglaubliche Geschlossenheit. Die Parteiführung und jetzt auch die Abteilung Südende für meinen Steglitzer Wahlkreis haben mich jeweils einstimmig nominiert. Es gibt ein großes Vertrauen und auch eine hohe Mobilisierung. Die Partei ist hoch motiviert.
taz: Wir kennen die Berliner SPD ja auch ein wenig. Und Geschlossenheit war bisher nicht ihre Stärke.
Krach: Sie müssen da unterscheiden zwischen inhaltlich kontroversen Diskussionen und dem Umgang miteinander. Das heißt nicht, dass es nicht unterschiedliche Positionen gibt. Ich finde Olympia gut, aber das gilt sicher nicht für alle in der SPD.
taz: Und auch nicht alle lehnen wie Sie die Vergesellschaftung von privaten Wohnungskonzernen ab.
Krach: Auch hier sind wir auf einem guten Weg. Die Fähigkeit zu guten Kompromissen, die Geschlossenheit, die spüre ich auch hier.
taz: Sie gehen also optimistisch in den Parteitag am 15. November?
Krach: Absolut.
taz: Was ist denn Ihre Botschaft an die Wählerinnen und Wähler? Die Linkspartei sagt: Alle, die gegen die da oben sind, kommen bitte zu uns. Kai Wegner sagt: Weiter so. Was sagt die SPD? Irgendwo dazwischen?
Krach: Weder das eine noch das andere ist der richtige Weg. Wenn wir enteignen, ist noch lange nicht alles gut. Da ist noch keine einzige zusätzliche Wohnung da. Wir setzen auf andere Maßnahmen, auf die Mietpreisbremse, auf die konsequente Verfolgung von Mietwucher und illegalen Ferienapartments und auf einen Stopp dieses Wahnsinns mit möblierten Wohnungen. Es reicht nicht, wie Kai Wegner zu sagen, wir machen einfach so weiter wie bisher. Das Gleiche gilt bei der Mobilität. Wir müssen die Außenbezirke stärker einbinden. Wir müssen beim öffentlichen Nahverkehr und bei der Fahrradinfrastruktur wieder das Tempo aufnehmen, das wir schon einmal hatten. Es gibt viele Dinge, die wir schneller angehen und besser umsetzen müssen.
taz: Herr Momper, was ist Ihre Wahrnehmung? Wofür steht die SPD in Berlin?
Momper: Für die Sozialpolitik.
taz: Das sagt die Linke auch.
Momper: Da ist das Original immer noch besser als die Kopie. Die SPD muss für die breite Masse der Menschen da sein und ihre Interessen vertreten. Auch wenn sie das mitunter etwas aus den Augen verloren hat.
taz: Wo zum Beispiel?
Momper: Wenn sie sich zu sehr mit Randproblemen beschäftigt. Zum Beispiel beim Gendern. Das ist nicht das, womit wir die Wählerstimmen gewinnen. Wenn man das Soziale mit dem ganzen Herzen der Partei betreibt, wird das schon Früchte tragen.
taz: Ist die SPD also die Partei, die den Spagat zwischen den Themen der Wählerinnen und Wähler in der Innenstadt und denen am Stadtrand schaffen kann?
Krach: Wir sind die einzige Partei für ganz Berlin. Wir sind die einzige Partei, die Antworten für die ganze Stadt anbietet.
taz: Nun gibt es eine neue Umfrage, die die SPD seit Monaten erstmals wieder vor den Grünen sieht. Wollen Sie zur Wahl am 20. September 2026 auch vor der Linken einlaufen oder sogar noch vor der CDU?
Krach: Definitiv. Auf Platz eins.
taz: Und was passiert, wenn sich in ersten Gesprächen mit der Linken herausstellt, dass sie nicht bereit ist, Kompromisse zu schließen oder sogar gar nicht regieren will?
Krach: Mein Eindruck ist, dass die Linkspartei wieder in die Regierungsverantwortung will. Den Anspruch finde ich erst einmal richtig. Das ist eine gute Voraussetzung, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit wem es dann am Ende verlässliche Mehrheiten gibt, wird sich zeigen. Das entscheiden die Wähler. Aus meiner Sicht gibt es für uns als SPD drei Optionen. Die Grünen, die CDU und die Linkspartei.
taz: Walter Momper war 1989 ein Pionier, er hat das erste Berliner Bündnis mit den Grünen, damals noch Alternative Liste, gebildet. Falls nun die Linkspartei ausfällt, schließen Sie also auch eine Keniakoalition mit CDU und Grünen nicht aus. Auch das wäre neu in Berlin.
Krach: Ich schließe gar nichts aus, außer der AfD.
taz: Herr Momper, Sie haben 1989, noch vor dem Fall der Mauer, die erste Berliner Stadtbilddebatte erlebt. Damals ging es um den sogenannten Polenmarkt am Potsdamer Platz. Der war der Springer-Presse wegen seiner Ärmlichkeit ein Dorn im Auge. Jetzt gibt es wieder eine Stadtbilddebatte …
Momper: Anders als der Bundeskanzler sehe ich im Stadtbild kein Problem. Ich sehe aber Armut, Bettelei, Obdachlosigkeit. Das müssen wir ändern.
Krach: Das, was Friedrich Merz da gesagt hat, hilft niemandem. Es führt ausschließlich zu einer Polarisierung, bei der viele Menschen, die zu unserer Gesellschaft dazugehören, die unser Land mit am Laufen halten, verletzt werden. Statt Zusammenhalt zu befördern, treiben solche Aussagen unsere Gesellschaft weiter auseinander. Natürlich gibt es Probleme in unseren Städten. Wir haben Leerstand in den Innenstädten, wir haben Sicherheitsfragen, die zu lösen sind, Fragen der Sauberkeit. Aber dazu habe ich noch keinen Beitrag von Friedrich Merz gesehen.