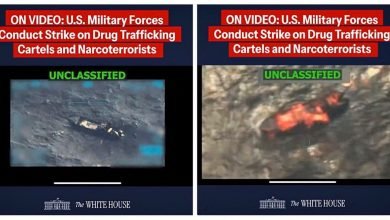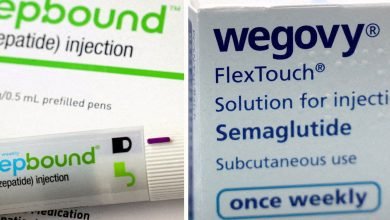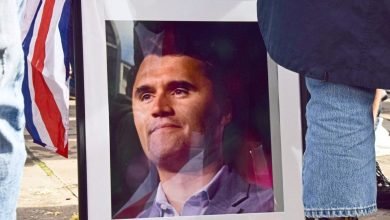Long Covid und ME/CFS: Spitzenforscher fordern internationale Forschungskooperationen |ABC-Z

Die Corona-Pandemie ist vorbei, das SARS-CoV-2-Virus aber kursiert weiterhin. Es verändert sich, wird mal etwas infektiöser oder wenige infektiös, mal gefährlicher oder harmloser in den Symptomen, die es auslösen kann. Und auch wenn die Gesundheitssysteme nicht mehr überlastet werden, so ist das Virus nicht harmlos: Immer wieder erkranken Menschen schwer, manche erholen sich nicht davon. Long Covid, Post-Covid und das verwandte ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) sind für die Betroffenen und ihre Angehörigen nur schwer zu ertragen.
Wie viele Menschen in Deutschland genau betroffen sind, ist unklar, es gibt kein Register. Der Gesellschaft für ME/CFS zufolge leiden geschätzt 650.000 Menschen in Deutschland an dieser Erkrankung, vor der Pandemie sollen es etwa 250.000 gewesen sein.
Aber nicht nur die Betroffenen und ihre Angehörigen, sondern auch die Gesellschaft leidet darunter, dass Viren kursieren, die Menschen schwer krank und arbeitsunfähig machen. Mit einer internationalen Deklaration wollen Wissenschaftler nun die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Millionen Menschen weltweit an von Viren wie Corona ausgelösten chronischen Erkrankungen leiden und dass es einer internationalen Anstrengung bedarf, um die Krankheitsmechanismen und Therapien zu erforschen.
Mehr als 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Deklaration unterzeichnet. Darunter ist etwa Akiko Iwasaki, Immunbiologin an der Yale University. Sie sagt: „Forschung und Medikamentenentwicklung im Bereich Long Covid und ME/CFS müssen zur Priorität gemacht werden, wenn wir den Menschen, die mit diesen Erkrankungen leben, wirksame Therapien zur Verfügung stellen wollen. Ich bin überzeugt, dass wir durch disziplin- und sektorübergreifende Kooperationen wichtige Fortschritte erzielen können.“ Fachwissen und Ressourcen der Grundlagenforschung und der Industrie müssten gebündelt werden. „Deshalb fordern wir den Aufbau zielgerichteter Partnerschaften zwischen Wissenschaft, Biotechnologie und Pharmaindustrie.“
Trotz der hohen Krankheitslast und der „erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Kosten“ sei ME/CFS stark unterfinanziert und unzureichend erforscht, heißt es in der Erklärung. Weder die medizinische Ausbildung sei ausreichend noch die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur. Die Arzneimittelentwicklung für ME/CFS und Long Covid sei „in der etablierten Pharmaindustrie derzeit praktisch nicht vorhanden“, heißt es in der Deklaration.
„Erkrankung mit hoher Priorität“
Die Wissenschaftler betonen, dass es aus moralischen, medizinischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen notwendig sei, massiv in die internationale Forschung zur Pathophysiologie der Syndrome zu investieren. „Regierungen, Gesundheitsministerien und internationale Gremien müssen ME/CFS und Long Covid als Erkrankungen mit hoher Priorität für eine gezielte Finanzierung einstufen“, heißt es – so, wie es auch bei anderen chronischen Erkrankungen geschehe, die ähnlich weit verbreitet seien. Es müsse mehr geforscht werden, um Medikamente und Therapien zu finden. Auch Wirkstoffe, die eigentlich für andere Indikationen zugelassen sind, sollten auf ihren Nutzen bei der ME/CFS- und Long-Covid-Behandlung geprüft werden.
Carmen Scheibenbogen, Medizinerin und Leiterin des Charité Fatigue Centrums (CFC) an der Berliner Charité und in Deutschland die wohl prominenteste Stimme der Wissenschaft in diesem Bereich, ist Initiatorin der Deklaration. Sie sagt: „Unser Verständnis über die Ursachen von ME/CFS und Long Covid hat in den letzten fünf Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Wir sind heute zuversichtlicher denn je, Ansatzpunkte für biomedizinische Behandlungen identifizieren zu können. Gemeinsam müssen wir unsere Anstrengungen jetzt darauf
konzentrieren, geeignete Biomarker zu identifizieren und potentiell heilende Behandlungen zu entwickeln.“ Dies müsse weltweit und in enger Zusammenarbeit mit Regierungen und Pharmaunternehmen geschehen.
Wie auch bei anderen Erkrankungen fordern die Unterzeichner der Deklaration, den neueren partizipativen Ansatz zu wählen: Patienten und Betroffene sollen demnach beispielsweise gefragt werden, welche Forschungsfragen ihrer Meinung nach vorrangig bearbeitet werden sollen. In der Deklaration wird auch gefordert, dass ME/CFS und Long Covid auch in der medizinischen Ausbildung stärker berücksichtigt werden sollen.
„Die Zeit zu handeln ist jetzt“, heißt es. „Die Last der Untätigkeit wird weiterhin vielen Menschen großes Leid zufügen und Gesellschaften, Volkswirtschaften und Gesundheitssysteme stark belasten. Wir sind vereint in unserem Engagement, wirksame Behandlungen für ME/CFS und Long Covid zu finden und allen Betroffenen Hoffnung zu geben.“
Dass Long Covid und ME/CFS noch immer nicht von allen Medizinern als ernst zu nehmende Erkrankungen anerkannt sind, erleben Patienten immer wieder. Zudem ist das Klima zwischen denjenigen, die, entgegen des Stands der wissenschaftlichen Erkenntnis, die Krankheit als rein psychosomatisch abstempeln wollen, und denen, die eine biologische Pathophysiologie dahinter sehen, aufgeheizt. Immunologen, Internisten, Neurologen und Psychiater streiten, Hausärzte sind häufig überfordert. Die Symptome der Erkrankten sind diffus, die Pathophysiologie nur in Ansätzen verstanden.
Verbreitung von Falschinformationen
Zuletzt hatte eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Neurologie für Streit gesorgt: Wie die F.A.Z. berichtete, wurde darin suggeriert, ME/CFS sei psychosomatisch begründet. Bekannte Zweifler an den physiologischen Ursachen der Erkrankung hatten diese Stellungnahme unter anderem in den sozialen Medien dann als Bestätigung ihrer Sichtweise verbreitet. Dass dies nicht dem wissenschaftlichen Konsens entspricht, wurde unter den Tisch fallen gelassen.
In einem klarstellenden Interview hatte der Generalsekretär der Gesellschaft für Neurologie, Peter Berlit, ebenfalls in der F.A.Z. daraufhin erklärt, die Neurologen seien keineswegs der Meinung, ME/CFS und Long Covid seien psychosomatisch bedingt. Nach Berichten von Suiziden unter den Betroffenen hätte die Stellungnahme zum Ziel gehabt, den Patienten leichteren Zugang zu einer psychosomatischen Betreuung zu ermöglichen.
Ob die Deklaration der Wissenschaftler dazu führen wird, dass die durch Viruserkrankungen ausgelösten massiven Einschränkungen ernster genommen, Ursachen und Therapien besser erforscht werden und sich die Versorgungssituation für die Patienten verbessert, ist nicht abzusehen.
Glaubt man einer Modellierung von Risklayer und der ME/CFS Research Foundation, wäre dies aber auch für die Gesellschaft wünschenswert. Denn demnach haben die Erkrankungen in den Jahren 2020 bis 2024 schätzungsweise Kosten in Höhe von 250 Milliarden Euro verursacht.
David Putrino, Professor für Rehabilitation und Human Performance an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, New York, hat die Deklaration ebenfalls unterzeichnet. Er sagt: „Es ist dringend notwendig, den Millionen von Menschen mit postakuten Infektionssyndromen eine maßgeschneiderte medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Zwar gibt es bereits erste Bemühungen, wirksame Behandlungen zu finden, doch um zeitnahe Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir dringend weitere Forschung und klinische Studien. Als Forschende und Ärzte werden wir unser Bestes tun, um unser Fachwissen zu nutzen und unser Verständnis über die Diagnose, Behandlung und letztendlich Prävention dieser Erkrankungen weiter zu entwickeln. Partnerschaften mit der Privatwirtschaft können uns dabei einen großen Schritt
voranbringen.“