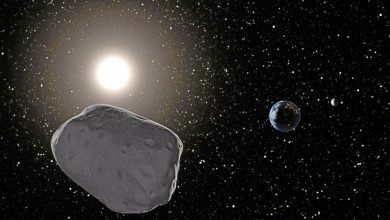So gut ist die Inszenierung von „Hinkemann“ am Deutschen Theater | ABC-Z

Berlin. Anne Lenk inszeniert Ernst Tollers Drama nicht nur als Kritik an jeglichem Krieg, sondern auch als Beitrag zur Gender-Diskussion.
Hören Sie! Sehen Sie! Staunen Sie! Das Deutsche Theater lädt zu einer Sensation. Es zeigt Homunculus. Den stärksten Mann der Welt. Vom Bühnenhimmel wird er herabgelassen. Eine echte Luftnummer. Ein muskulöser Mann. Nackt bis auf ein güldenes Höschen. Und dann beißt er lebenden Mäusen und Ratten die Kehle durch. Bis das Blut aus seinem Mund rinnt.
Aber ach! Alles Fake. Von wegen Mannesstärke. Der vermeintliche Homunculus, Eugen Hinkemann (Moritz Kienemann) ist ein Kriegsversehrter. Man hat ihm das Männlichste weggeschossen: sein Gemächt. Er hat nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz buchstäblich keine Eier mehr. Nix los in der Hos’. Darum fühlt sich dieser Hinkemann minderwertig, ja wertlos, vor allem vor seiner Grete (Cornelia Gloth).
Die Genitalien weggeschossen und der Männlichkeit beraubt
Aber weil die Versehrtenrente so schmal ist und kaum reicht für ihre kleine Bude, muss er schaffen gehen. Und lässt sich auf dem Jahrmarkt von einem Budenbesitzer zu ausgerechnet dieser Nummer überreden. Auch hier die Scham: noch einmal ausgeschlachtet zu werden, nach dem Krieg nun als Jahrmarktsensation. Der beste Freund Paul (Jeremy Mockridge) macht sich derweil an seine Grete ran, die hat doch schließlich auch Gelüste. Und die gehen dann zusammen auf den Jahrmarkt. Und sehen Hinkemann als Homunculus.
Lesen Sie auch: Im Maschinenraum der Demokratie: „Newsroom“ im Theater an der Parkaue
Beengte Verhältnisse: Hinkemann und seine Grete (Lorena Hanschin). Konrad Fersterer
© Konrad Fersterer | mail@konradfersterer.com
Ernst Toller hat mit seinem Heimkehrerstück „Hinkemann“ eigene Traumata aus dem Ersten Weltkrieg verarbeitet, als er wegen seiner revolutionären Aktivität in der Münchner Räterepublik fünf Jahre in Festungshaft saß. Die Uraufführung erfolgte 1923, da saß er noch immer in Haft, die Aufführungen im Jahr darauf konnten in Berlin und Wien nur unter Polizeischutz stattfinden, weil die Nazis Vorführungen in Dresden gestört hatten. So sehr war ihnen Toller, dessen Bücher sie später verbrennen sollten, damals schon ein Dorn im Auge.
Ein expressionistischer Horrortrip. Mit Anleihen am Stummfilm
Nun gibt es wieder Krieg in Europa. Und das Deutsche Theater hievt „Hinkemann“ auf die Bühne. Regisseurin Anne Lenk verschachtelt dabei wie üblich die Bühne, um ihre Figuren voneinander zu isolieren. Mitten auf die große Rampe schieben sie und ihre Dauerbühnenbildnerin Judith Oswald eine Art Hexenhäuschen. Ein Raum im Raum, ein Guckkasten mit verzerrter, verengender Perspektive und schrägen Möbeln. Bilder wie aus expressionistischen Stummfilmen jener Jahre 1921/22, in denen „Hinkemann“ entstand, man denkt vor allem an den Klassiker „Das Cabinet des Dr. Caligari“, der ja auch in Jahrmarktbuden spielt. Und wie von dem somnambulen Mörder Cesare im Film gibt es hier projizierte Großaufnahmen von Hinkemann.
In dem schmalen Kasten führen Hinkemann und seine Grete ein beengtes Dasein, in fahlgrünen Räumen und fahlgrünen Kostümen. Ein weiterer Guckkasten dient als Stammtisch, ein kleinerer als Liebesnest von Grete. Nur die Jahrmarktsensation wird nicht in einer Schaubude gezeigt. Sondern auf großer, leerer Bühne vor dann blutrotem Plastikvorhang. Und dann auch als Projektion auf das Liebesnest, von wo aus Paul und Grete den Hinkemann die Ratten fressen sehen. Wofür Paul ihn vor allen verspottet. Und der Lächerlichkeit preisgibt. Ein expressionistischer Horrortrip.
Lesen Sie auch: Anna Sofie Keller Brandsborg und Sergej Morozov inszenieren Kammeropern an der Deutschen Oper

Zurschaustellung von Männlichkeit: Dafür dürfen acht Bodybuilder auf der Bühne posieren. Und ihre Muskeln spielen lassen.
© Konrad Fersterer | Konrad Fersterer
Als Hinkemann brilliert Moritz Kienemann, der ihn anfangs ganz leise spielt, kaum zu hören ist, buchstäblich kleinlaut ist. Aber später seine Verzweiflung herausbrüllen wird. Keiner hat Mitleid mit seinem Hinkemann. Nur er selbst hat welches. Sogar für den, der , der auf ihn geschossen hat, und von dem er ahnt, dass er genauso arm dran ist wie er. Weil an seiner Misere ganz andere Schuld sind. Die, die den Krieg vorangetrieben haben. Damit ist „Hinkemann“ ein starker, immer aktueller Beitrag gegen Kriegsgelüste aller, auch aktueller Art. Hat sich nicht auch ein Kriegstreiber aus Russland schon mal reitend mit freiem Oberkörper in all seiner Männerpracht inszeniert?
Zurschaustellung von Männlichkeit durch acht Bodybuilder
Es ist erschreckend, wie modern Tollers Stück damals war. Und wie aktuell es auch heute zu uns spricht. Dazu bedarf es nur weniger Anachronismen, um es heutig zu machen. Wenn mal von „Dirty Dancing“ die Rede ist, wenn Grete wie ein „Masked Singer“ als Vögelchen verkleidet auf der Bühne singt. Und vor allem in einer stummen Szene, wenn Schlagzeilen von damals in altdeutscher Schrift über die Bühne projiziert werden, die dann aber durch aktuelle Nachrichtenmeldungen abgelöst werden.
Lenk belässt es dabei nicht bei den offensichtlichen Kriegsanalogien und -treibereien. Im Gegenteil: Sie verortet den Stoff in die derzeitige Diskussion um Gender, Geschlechter- und Transidentitäten. Und da erweist sich „Hinkemann“ als wahrer Prototyp. Ein Cis-Mann, der in seiner Männlichkeit verletzt ist und dadurch seine Identität verliert. Der Schaubudenbesitzer (Jonas Hien) fährt in einem wahnwitzigen Raketengeschoss mit phallischem Kanonenrohr vor, von dem Hinkemann fast erschlagen wird. Bevor der dann als Homunculus vom Seil gelassen wird, lassen erst mal acht Statisten, die offensichtlich aus einem Muckibude gecastet wurden, ihre Muskeln spielen. Während Pauls Kollegen im Bierzelt Sprüche klopfen. Typische Manns-Bilder.
Lesen Sie auch: Der Mensch ist käuflich: „Der Besuch der alten Dame“ in der Vagantenbühne

Die vielleicht eindrücklichste Szene: BDM-Mädees und Hitlerjungen Hinkemann tanzen zu Schlagzeilen von einst, die bald von modernen Nachricht abgelöst werden.
© Konrad Fersterer | mail@konradfersterer.com
Nach dem Zwangsouting, mit dem Paul Hinkemanns Potenzlosigkeit publik macht, sind die Hosen runtergelassen. Danach läuft Hinkemann konsequent in einem Kleid herum. Versucht noch, bei BDM-Mädels und Hitler-Jungen mit übergroßen Puppenköpfen (auch darunter verbergen sich die Bodybuilder) mitzutanzen. Vergeblich. Er ist ausgestoßen. Und dazu passt die projizierte Schlagzeile vom Dekret von Transmenschen in den USA. Während Hinkemann die zarte These in den Raum stellt, das nicht das Geschlecht seine Identität bestimmt, sondern – die Seele.
Link entdeckt Ernst Toller neu. Und interpretiert ihn am Ende mutig um
Manchmal geht Anne Verkastelungs-Dramaturgie grandios auf, wie bei ihrem Setzkasten in „Maria Stuart“. Mal verkommt sie zur Masche wie zuletzt in „Die Katze auf dem heißen Blechdach“. „Hinkemann“ dagegen ist wieder ein ganz großer Wurf. Mit dem die Regisseurin ein fast vergessenes Toller-Stück in den Fokus rückt. Und es doch ganz frei bearbeitet und gar uminterpretiert.
Der Wochenend-Newsletter der Berliner Morgenpost
Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter mit Tipps zum Wochenende in Berlin
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der
Werbevereinbarung
zu.
Bei Toller endet alles in der Katastrophe. Obwohl Grete reuig zu ihrem Hinkemann zurückkehrt, treibt er sie mit seinem Minderwertigkeitswahn in den Tod. Bei Lenk dagegen eine starke andere Botschaft: Am Ende schiebt Grete all die Räume und Wände, die zwischen den beiden stehen, beherzt beiseite. Und das Kind, das sie von einem anderen erwartet, will Hinkemann als das seine großziehen. Ein vorsichtig optimistisches Happy End. Als moderne Patchwork-Familie.
Deutsches Theater, Schumannstr., 13a, Mitte. Kartentel.: 28441225. Termine: 30. April, 7., 16., 19. und 31. Mai.