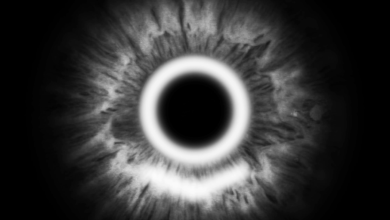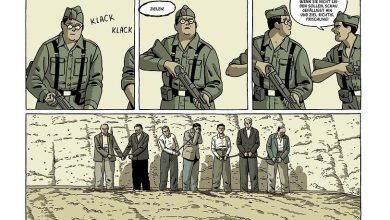Singen für das eigene Land – Kultur | ABC-Z

In diesem Jahr dirigierte Elo Üleoja „nur einen kleinen Chor“, wie sie sagt: etwas mehr als 1000 Kinder. Früher hat sie auch Chöre von 20 000 Sängern dirigiert, Männer, Frauen, Kinder. Elo Üleoja, 61 Jahre alt, hat ihr Leben dem wichtigsten estnischen Kulturgut verschrieben: den Liedern. Als Dirigentin war sie nun schon zum neunten Mal beim Singfest in Tallinn dabei – auf Estnisch heißt es Laulupidu. Alle fünf Jahre treffen und präsentieren sich hier Estlands Chöre.
In Estland teilen sich rechnerisch 32 Menschen einen Quadratkilometer – in Deutschland sind es 240. Man kann also lange durch die von Mooren geprägte Landschaft laufen und nur das eigene Pfeifen im Walde hören. Doch zum Singen kommt man gern zusammen, bereits 1869 fand das erste Laulupidu statt – Jahrzehnte vor der staatlichen Unabhängigkeit. Lettland und Litauen haben ähnliche Feste. Seit jeher geht es beim Singen auch um das Bewahren der Nation. Das Singen ist eine Art Verteidigung gegen all die fremden Mächte, die immer wieder das Land besetzten. Nun fühlt sich Estland wieder sehr bedroht. Vielleicht waren auch deshalb in diesem Jahr die Karten so schnell ausverkauft.
Elo Üleoja stand das erste Mal als Kind Anfang der Siebzigerjahre auf der großen, halb überdachten Singfest-Bühne, die einer Muschel ähnelt. Damals sang sie im Chor, nur wenige Jahre später, als Schülerin am Gymnasium, dirigierte sie das erste Mal. Später studierte sie am Konservatorium. In diesem Jahr nun war sie die meistbeschäftigte Dirigentin, neun Chöre hat sie anderthalb Jahre lang für das Singfest vorbereitet, beim Fest selbst werden sie dann Teile eines großen Chors.
Denn erst in den letzten Tagen vor dem Konzert üben alle Chöre gemeinsam – mit 1000 oder bis zu 20 000 Sängern. Vor mindestens doppelt so vielen Zuhörern. Wie fühlt es sich an, 20 000 Sängerinnen und Sänger anzuleiten? Im Vergleich zu 20?
20 Sänger, sagt Üleoja, das sei vergleichbar mit einem kleinen Bach. „20 000 Singstimmen – das ist wie ein Ozean“, sagt sie und spannt die Arme aus. „Sie müssen einem solchen Chor mehr Zeit geben, der Klang trägt weit, es braucht Zeit zum Ausklingen und Atemschöpfen.“ In diesem Jahr wurde auch in den verschiedenen Dialekten des Landes gesungen. Alle gelten als bedroht, sie unterscheiden sich teilweise so stark, dass Sprecher verschiedener Dialekte Schwierigkeiten haben könnten, sich untereinander zu verstehen. Und das in einem Land mit knapp 1,4 Millionen Einwohnern.
Zu Sowjetzeiten waren Lieder auf Russisch Pflicht
Das Laulupidu durfte auch stattfinden, als Estland noch zur Sowjetunion gehörte. Üleoja erinnert sich gut an diese Zeit. Die Moskauer Führung nutzte das Fest, um sowjetische Propaganda zu verbreiten. Es mussten auch Lieder auf Russisch gesungen werden, zum Lobe des Marxismus-Leninismus. Auch das Abschlusslied musste ein solches Revolutionslied sein. Doch einmal, in den Achtzigern, stimmten die Sängerinnen und Sänger, als der Dirigent die Bühne verlassen hatten, noch eine estnische Weise an. „Es war ein sehr heikler Moment“, erinnert sich Üleoja. Die Feste wurden vom Regime streng bewacht. Wenn nicht die Perestroika schon eingesetzt hätte, hätte es wohl mit großer Härte reagiert, vermutet sie. Später, als die Sowjetunion zerfiel, beteiligte sich Üleoja spontan mit einem Herrenchor von Ingenieuren daran, am Tallinner Domplatz die estnische Flagge gegen russische Soldaten zu verteidigen.
Heute wird auf dem Laulupidu wieder ausschließlich Estnisch gesungen – auch die Chöre, die aus dem Ausland anreisen, sei es aus Deutschland oder Japan, studieren das estnische Repertoire ein. Eignet sich Estnisch mit seinen vielen Vokalen gut zum Singen? Üleoja lacht, wiegt den Kopf. „Unsere Vokale sind so flach wie das Land.“ Sie säßen zu eng im Hals. Dann macht sie vor, was jeder Sänger kennt: Zunge runter, Mund weit auf – damit der Vokal sich öffnet und klar und hell fliegen kann.